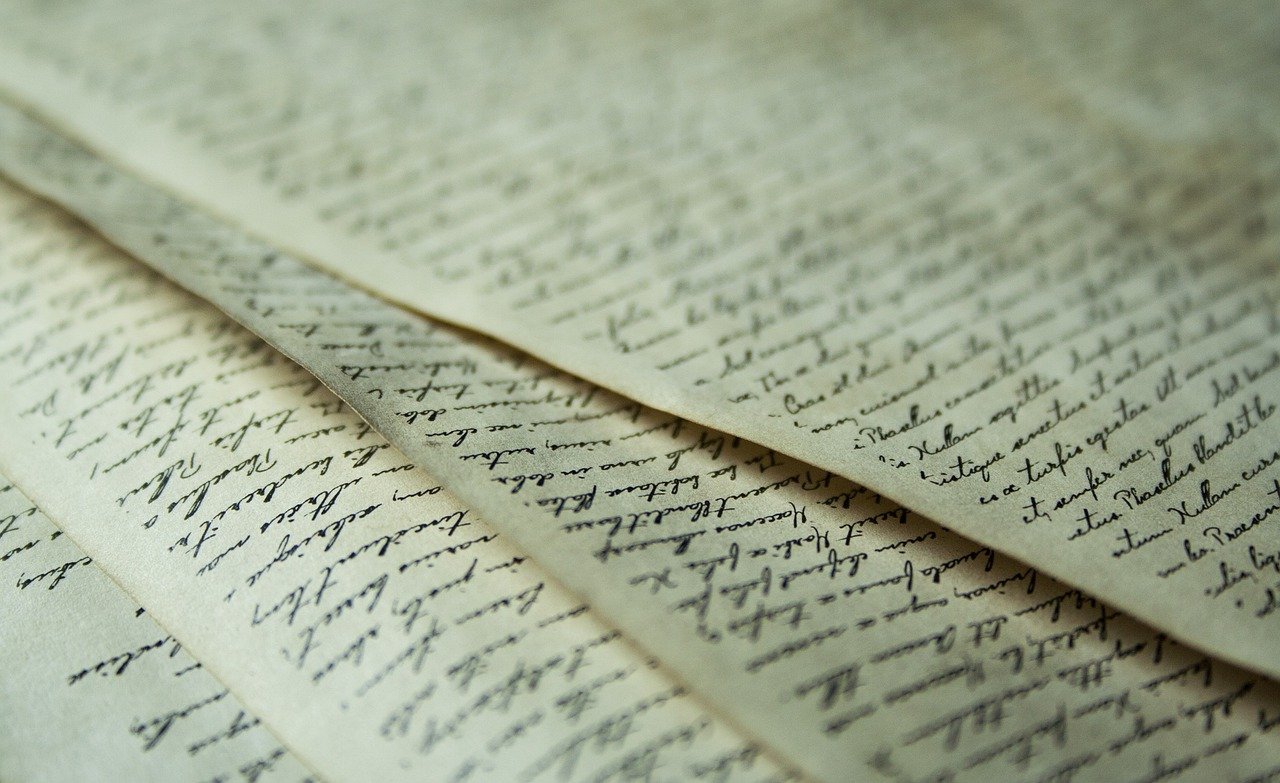
Zeitreisende Briefe, Romane als Zeitreisen
Über „Das also ist mein Leben“ von Stephen Chbosky, „Verlorene der Zeiten“ von Amal Eh-Mohtar und Max Gladstone … und noch ein paar andere Romane
Ich habe in den letzten Wochen (u. a.) zwei sehr unterschiedliche Romane gelesen: Stephen Chboskys „Das also ist mein Leben“ sowie „Verlorene der Zeiten“ von Amal El-Mohtar und Max Gladstone. Das eine ist ein erstmals 1999 veröffentlichter Coming-of-Age-Roman, auch bekannt unter seinem Originaltitel „The Perks of Being a Wallflower“ oder seinem dt. Erstveröffentlichungstitel „Vielleicht lieber morgen“ (was zugleich der Titel der Verfilmung von 2012 ist). Übersetzt wurde die Neuveröffentlichung von Oliver Plaschka, die Buchwelt ist ja klein. Das andere ist ein Zeitreise-Kurzroman aus dem Jahr 2019, auch bekannt unter seinem Originaltitel „This Is How You Lose The Time War“, nun frisch von Simon Weinert auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht bei Piper.
Beide haben bei allen Unterschieden zwei Gemeinsamkeiten: Zum einen haben sie mehrere Preise abgeräumt. „Das also ist mein Leben“ nennt beispielsweise mehrere ALA Awards sein Eigen, „Verlorene der Zeiten“ gewann u. a. einen BSFA Award, einen Hugo und einen Nebula Award.
Zum anderen sind beides Briefromane. Nun, mehr oder weniger zumindest – in „Verlorene der Zeiten“ wechseln sich jeweils ein Szenario und ein daran anschließender Brief ab. Aber das reicht aus, um es als Briefroman zu bezeichnen.
Außerdem reicht es aus, dass ich den Moment nutze, um beide Bücher zugleich zu besprechen.
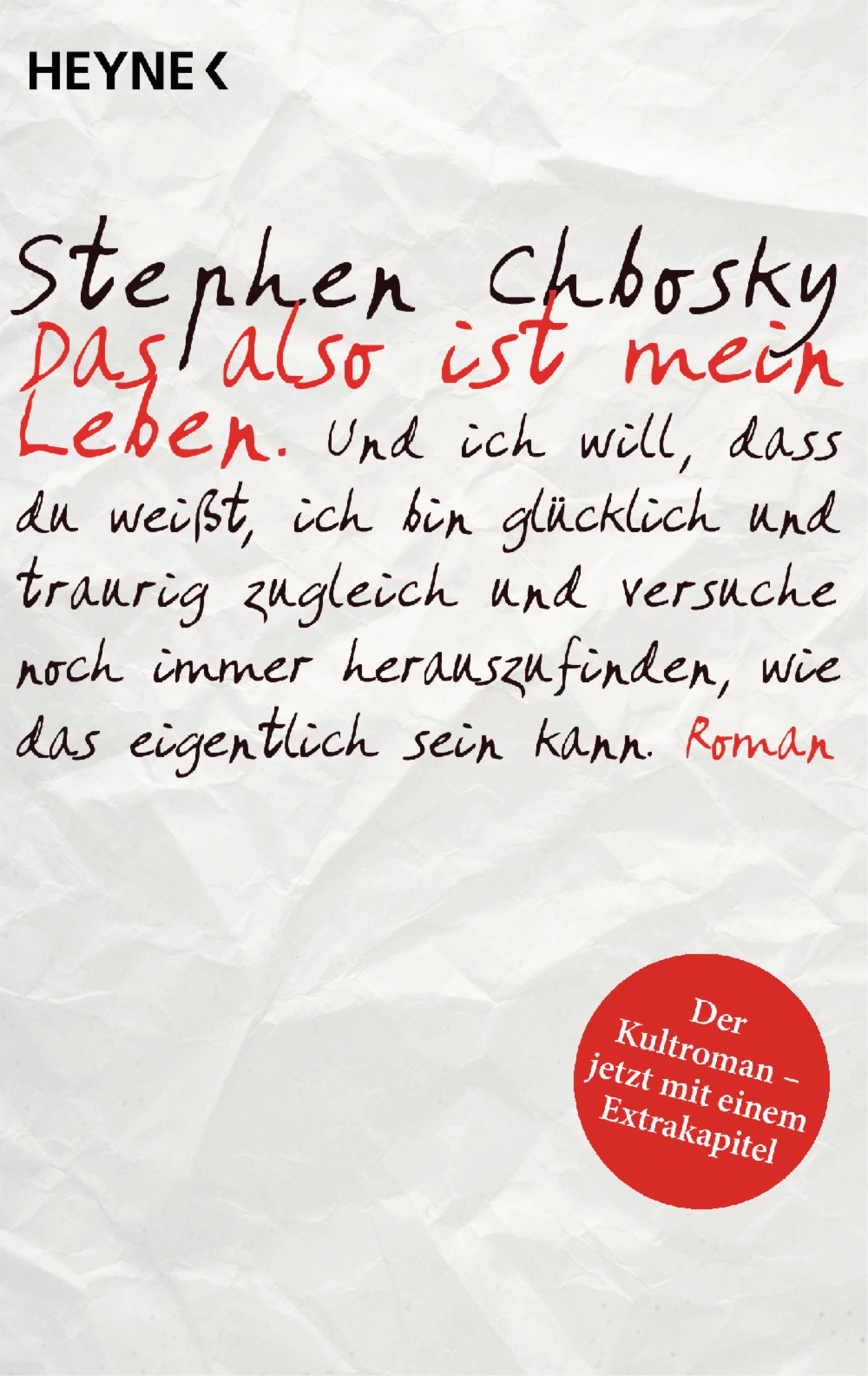
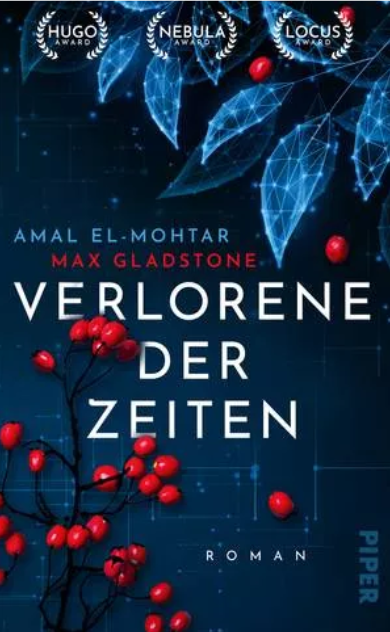
Im 18. und 19. Jahrhundert waren Briefromane in Europa ein Ding. Ihr wisst schon, „Die Leiden des jungen Werther“ und sowas. Als erster deutscher Briefroman gilt Sophie von La Roches „Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ von 1771 und natürlich musste ich nicht Wikipedia bemühen, um das herauszufinden, nein nein.
Die gute Sophie hat übrigens in meiner Nachbarschaft gewohnt, aber halt 250 Jahre vor mir. Trotzdem liegt der Duft des Fräuleins von Sternheim noch immer in der Luft, und die Uni Koblenz, die zum 1. Januar 2023 dank einer Neustrukturierung entsteht, hatte die Chance, sich Sophie von La Roche Universität zu nennen. Ich finde, das hätte sehr schön geklungen und wäre mal eine nette Abwechslung gewesen, aber stattdessen wird sie nun glaub ich … äh, Universität Koblenz heißen. Kreativ! Ich frage mich, wie viele arme Projektmitarbeiter sich vorher den Kopf über mögliche Namen zerbrechen mussten.
Wie auch immer. In der Phantastik hat der Briefroman ebenfalls Tradition, Elemente dessen nutzten schon Mary Shelley in „Frankenstein“, Robert Louis Stevenson in „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ oder Bram Stoker in „Dracula“. In der modernen Fantasy und Science Fiction finden sich u. a. Beispiele von Tamora Pierce („The Legend von Beka Cooper“), Gene Wolfe („The Sorcerer’s House“) oder Cherie Priest („The Borden Dispatches“) – zumindest, wenn wir den Brief auch etwas weiter fassen, etwa in Richtung Telegramme, Tagebucheinträge usw. Ein weiteres Beispiel ist „Sorcery and Cecelia“, was die meines Erachtens hierzulande unterschätzte Patricia C. Wrede gemeinsam mit Caroline Stevermer geschrieben hat. Beide teilen sich dabei eine Seite eines Briefaustauschs, womit sie auf dasselbe Prinzip zurückgreifen wie Amal El-Mohtar und Max Gladstone in „Verlorene der Zeiten“.
Auch unter der Jugend-Gegenwartsliteratur sind Briefromane bis heute immer mal wieder anzutreffen. Da wäre beispielsweise John Marsdens „Liebe Mandy, liebe Tracy“, was ich sicher ein Dutzend Mal gelesen habe und dessen ambivalentes Ende mich bis heute beschäftigt. Ich überlege, ob man darüber hinaus wegen der Chatprotokolle auch „Ich knall euch ab“ von Morton Rhue in diese Kategorie fassen könnte, aber vielleicht greift das zu weit. Gutes Buch dennoch, wenn mich meine Jugend-Erinnerung nicht trügt.
Jedenfalls: Auf ihre Art stehen offenbar sowohl „Verlorene der Zeiten“ als auch „Das also ist mein Leben“ in ihrer jeweiligen Genre-Tradition, wenngleich Briefromane heute sicher nicht mehr die üblichste Erzählform sind.
Von der Wissenschaft hinter Briefromanen habe ich wenig Ahnung. Aber es ist einleuchtend, dass es sich hierbei um eine sehr figurenzentrierte und vergleichsweise Tell-anfällige Variante handelt. Für Leute, die die Ich-Perspektive nicht mögen, muss es eine Tortur sein, für Show don’t tell-Puristen ebenfalls. Praktischerweise bin ich weder das eine noch das andere und empfinde es immer eher als Pluspunkt, wenn ich lese, dass etwas ein Briefroman ist. Ein bisschen mehr noch, wenn es, wie bei „Verlorene der Zeiten“ oder „Sorcery and Cecilia“, ein Dialog-Briefroman ist. Gute Dialoge sind für mich das A und O vieler Romane und definitiv wichtiger als … sagen wir, Actionszenen beispielsweise.
„Das also ist mein Leben“: Ich und die anderen
„Das also ist mein Leben“ hat keinen solchen Dialog. Die Briefe, die der Protagonist an einen unbekannten Empfänger schreibt, ähneln eher Tagebucheinträgen. Sie dienen auch nicht unbedingt als Meta-Element, sondern betonen die starke Ich-Perspektive des Buchs und zumindest am Anfang auch die Einsamkeit des Erzählers. Das Buch folgt dem Alltag von Charlie, frisch gebackener Highschool-Schüler, der nach dem Suizid seines besten Freundes erst mal ziemlich allein da steht und das Leben mit seinen Mitschülern und seine Familie wie durch ein Wasserglas beschreibt. Erst als er sich mit den Stiefgeschwistern Patrick und Sam anfreundet, gewinnt er einen neuen Freundeskreis. Und ab da wird fast nichts ausgelassen an dem, was es an Teenagerdramen so geben kann: erste Liebe, Drogenerfahrungen, sexueller Missbrauch, Homosexualität und Homophobie, psychische Erkrankungen und Suizid, ungewollte Schwangerschaft und Abtreibung – alles dabei.
Stellenweise empfand ich das schon als etwas zu viel des (Un-)Guten, zumal kaum eines der Themen wirklich die Zeit fand, aufgearbeitet zu werden. Aber genau da liegt auch wieder eine Stärke des Buches, das gelegentlich wertend ist, aber kaum Haltung einnimmt. Man fühlt sich beim Lesen tatsächlich hineinversetzt in Charlie, der eben zu Protokoll gibt, was um ihn herum passiert, das alles jedoch wie neutrale Kuriositäten annimmt, scheinbar zumindest.
Inhaltlich fühlte ich mich an verschiedene Romanen und Kurzgeschichten von Joey Goebel erinnert, stilistisch aber mehr an Anthony McCartens „Superhero“, wo wir ebenfalls diese Mischung aus Beobachtung, vorsichtiger Bewertung und teils frustrierender Machtlosigkeit des jugendlichen Protagonisten haben. Außerdem haben beide Bücher gemeinsam, dass sie nicht dem Coming-of-Age-trope der zerrütteten Familie anheimfallen, was ich sehr begrüße.
Allerdings will ich „Das also ist mein Leben“ ja eigentlich nicht mit „Superhero“ vergleichen, sondern mit „Verlorene der Zeiten“.
Das ist wiederum kein Coming-of-Age-Roman, sondern eher ein Walking-through-Ages-Roman.
“Verlorene der Zeiten”: Die Blauen und die Roten
Oberflächlich betrachtet erfahren wir nicht allzu viel über die beiden Personen, die sich in „Verlorene der Zeiten“ Briefe schreiben. Sie nennen sich Blau und Rot und sie arbeiten als Agentinnen für konkurrierende Auftraggeberinnen, die durch Eingriffe in die Zeit jeweils versuchen, diese in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Welches finale Ziel diese Auftraggeberinnen verfolgen? Unklar. Was genau die beiden Seiten und ihre Agentinnen ausmacht? Kann man sich auch nur zusammenreimen. Wer den Sieg davonträgt? Interpretationssache.
Wer alle Fragen beantwortet haben will, ist fehl am Platze bei diesem Kurzroman, denn das größere Ganze ist hier unwichtig. Rot und Blau wissen, worum es geht, der Lesende wird nur mitgeschleift, und das ist völlig in Ordnung so. Anfangs bekämpfen sich die beiden Agentinnen, doch dann hinterlässt Blau Rot einen ersten Brief. Ab da wird eine schöne Tradition daraus. Ob in Atlantis, in London oder im Tempel irgendeiner obskuren Sekte: Immer wieder hinterlassen Blau und Rot einander Briefe, verborgen vor den Augen ihrer Auftraggeberinnen. Anfangs von ihrer Konkurrenz geprägt, lernen sie einander kennen, schließlich sogar lieben. Doch dann wird Rot beauftragt, Blau aus dem Weg zu räumen.
Wenn man das so liest, klingt es fast schon nach einer klassischen Handlung, aber das trifft es nur bedingt. Es ist ein fragmentarischer Roman, voller verwinkelter Ebenen und Kommentare auf die Zeit, das Leben, das Schicksal, die Liebe, und deshalb sollte man nicht erwarten, ihn schnell durchlesen zu können, auch wenn er keine 200 Seiten umfasst. Na ja, kann man schon machen, aber im Grunde lebt dieser Roman davon, dass man zwischen den Zeilen und durch sie hindurch liest. Dass man sich an den kleinen Details und Kommentaren erfreut, die die beiden Schreibenden in den Text verwoben haben. Lässt man all diese Details weg und konzentriert sich auf die Makroebene, bleibt ein immersiver, bittersüßer Zeitagentur-Roman, der ein bisschen an die „Loki“-Serie erinnert, am Ende aber dadurch überrascht, dass er nicht überrascht. Soll heißen, am Ende nutzt er eine ähnliche Auflösung wie andere Zeitreise-Romane mit Romantik-Anteil, insbesondere fühlte ich mich an Elia Barcelós „Das Geheimnis des Goldschmieds“ erinnert. Ich will das gar nicht negativ klingen lassen, denn ich mag Barcelós Roman sehr, aber nach diesem Feuerwerk an newweirdesken Ideen war ich ein bisschen ernüchtert, dass sich „Verlorene der Zeiten“… nun, so aufgelöst hat, wie ich es rein vom Thema her erwartet hätte.
Ich empfehle aber ohnehin, dieses Buch nicht einfach zu lesen, sondern in es einzutauchen, sich darin fallen zu lassen wie sich die Protagonistinnen (im wahrsten Sinne des Wortes) durch die Zeit fallen lassen. Es ist eine Geschichte voller Geschichten und ein Panoptikum an Möglichkeiten. Trotz der Kürze überbordend, vollgestopft wie ein Kramladen, in dem man einerseits überfordert ist, andererseits stets neue Kostbarkeiten entdeckt. Das transportiert sich auch sprachlich, und diesen Schwall der Poesie zu übersetzen, war sicher keine leichte Sache.
Markige Stellen
Außerdem ist es ein Buch, um Markierungen zu machen. Ungut, wenn man jemand ist, der seine Bücher weitergibt, aber wozu gibt es Post-its.
Eine der Stellen, die ich wenig Weitergabe-tauglich mit Textmarker illuminiert habe, ist der Ausruf „Briefe als Zeitreisen, zeitreisende Briefe“. Innerhalb der Handlung lässt sich das sehr direkt interpretieren, aber die Briefe sind eben auch Zeitzeugnisse des jeweiligen Szenarios, in dem sich die Agentinnen gerade befinden. Und dieser Satz war der Punkt, an dem ich auf die Idee kam, dieses Buch mit „Das also ist mein Leben“ zu vergleichen, was außerhalb der Brief-Thematik ja doch etwas abseitig wirkt. Aber auf eine Art bietet auch Charlie den Lesenden eine Zeitreise an. Einerseits innerhalb der Handlung durch die Aufarbeitung von Vergangenem. Andererseits aber auch, vom Autoren unbeabsichtigt, in einem sehr realen Sinne, denn das Buch ist echt 90er. Als ich mit dem Lesen angefangen habe, war mir gar nicht bewusst, dass es schon so alt ist; ich kannte bis dato nur die Neuauflage von 2011. Trotzdem wird einem bei Lesen schnell klar, dass das Buch … nun, zumindest vor 2017 entstanden sein muss. Es ist spannend, es ist einnehmend, es ist zu Tränen rührend, aber es ist nicht didaktisch und echt nicht zimperlich. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es altersmäßig 15 Jahre „zu spät“ gelesen habe, als Teenager wäre es mir glaub ich zu nahe gegangen. Und omg, üble Vorstellung, das im Klassenverband zu lesen (offenbar ist das Buch recht beliebt als Schullektüre).
Anyway. Kommen wir zu einer anderen markierten Stelle: „Alle guten Geschichten bewegen sich von außen nach innen“, so schreibt es Blau in einem ihrer Briefe. Da wollte wohl jemand sein eigenes Buch kommentieren. Ich weiß nicht, ob ich dieser Aussage vollumfänglich zustimme, denn man kann dieses „außen“ auf sehr vielfältige Art deuten. Gewissermaßen fängt „Verlorene der Zeiten“ bereits innen an. Nur bei der Makro-Lesart, die ich hier ja gar nicht so empfehle, bewegen wir uns von außen nach innen. Allerdings ist bei dem Zitat auch von Einbettung die Rede. Blau und Rot erzählen nur eine scheinbar geradlinige Geschichte, am Ende werden sie in die einzelnen Ereignisse eingearbeitet. Bei „Das also ist mein Leben“ geschieht das ebenfalls, aber weniger bildlich. Vor allem deshalb, weil Charlie trotz der radikalen Ich-Perspektive selber Beobachter ist, und er insofern nicht nur seine eigene Geschichte, sondern auch die seiner Umwelt erzählt.
Seid ihr jetzt alle schon geflüchtet oder können wir uns noch eine Markierung vornehmen? Kommt, eine geht noch. „Ein Brief ist mehr als ein Text“, so heißt es ziemlich am Ende des Buchs. Na, das wollen wir doch hoffen! Eine ganze Sammlung von Briefen kann sogar einen Roman bilden. Oder zwei Romane. Zwei sehr verschiedene Romane, die ich trotz ein paar Kritikpunkten wärmstens empfehlen kann. In „Verlorene der Zeiten“ könnt ihr euch verlieren, in „Das also ist mein Leben“ könnt ihr euch finden (also … wenn ihr ein bisschen so tickt wie Charlie jedenfalls). Gönnt euch.
[Danke an den Piper-Verlag für die Zusendung eines Exemplars von „Verlorene der Zeiten“]
6 Gedanken zu „Zeitreisende Briefe, Romane als Zeitreisen“
Ich habe „This Is How You Lose The Time War“ im Original gelesen und fand ihn sehr, sehr herausfordernd. Das macht mich neugierig auf die Übersetzung (schade nur, dass der deutsche Verlag sich diesen langweiligen Titel ausgedacht hat).
Ja, vom Titel bin ich auch etwas enttäuscht, das wird der Sprachgewandtheit des Texts nicht gerecht. Aber das Cover finde ich … nicht unbedingt schöner, aber passender als das Original.