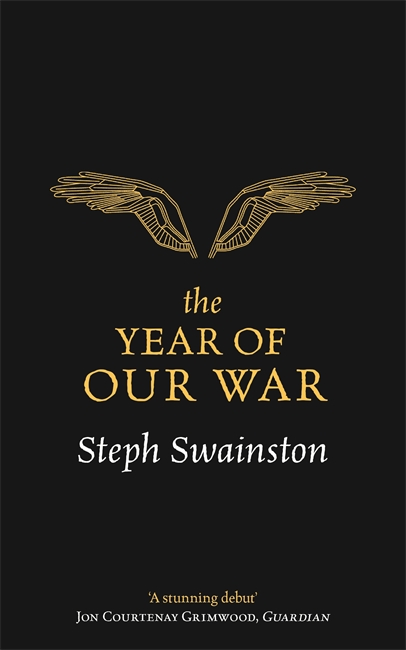
Das reaktionäre Andere in der Contemporary Fantasy …
… und darüber hinaus
In „A Midnight Opera 2“ gibt es diese Szene, in der Elizabeth Bathory in Gothickluft in eine Kneipe stolziert, wo sich die Geliebte ihres Erzfeinds (= Held der Geschichte) gerade ihrem Schwermut hingibt. Als geneigter Leser der Reihe ahnt man, was jetzt kommt: Die Kleine wird getötet, Lady Bath badet in ihrem Blut, großes Drama etc. pp. Vielleicht war das auch Bathorys Plan, aber sie überlegt es sich dann doch anders. Die beiden Frauen schütten einander ihre Herzen aus, die ein paar Jahrhunderte ältere gibt der jüngeren Lebenstipps und nach der großen Selbsterkenntnis folgt eine wilde Partynacht.

A Midnight Opera 2
©Tokyopop (US)
Es ist aus verschiedenen Gründen meine Lieblingssequenz: Erstens, weil vor allem Bathorys Emotionen durch die Zeichnungen wunderbar transportiert werden. Zweitens, weil Bathory dadurch noch cooler als eh schon rüberkommt. Und drittens, weil hier mit den Erwartungen des Lesers gespielt wird. Die Antagonistin wird zur Freundin der Mistress in Distress (zumindest für eine Nacht) und verhält sich dabei sehr 21. Jahrhundert. Nix mit Blutbad und 17.-Jahrhundert-Attitüde. Im Gegensatz zur Inquisition ist Bathory im Hier und Jetzt angekommen und wird prompt zu einer weitaus vielschichtigeren Figur, die sich von ihrem eigenen Stereotyp loslöst.
Ach, immer diese Gegenwart!
Selbst in der Contemporary Fantasy ist es verhältnismäßig selten, dass sich die Anderen auf das Niveau der Gegenwart begeben. Das (späte 20. oder) 21. Jahrhundert ist die Welt der Menschen und um das Fremde der Feenwesen und Co. darzustellen, greifen Autoren weiterhin gerne darauf zurück, sie als nostalgisch darzustellen. Oder sagen wir lieber – als antiquitiert.
Meist wird das mit der längeren Lebenszeit der Anderen in Verbindung gebracht: Dieser Epochenwechsel geht für sie so schnell, dass sie paradoxerweise mehr Zeit brauchen, um sich anzupassen; 500 Jahre Kultur- und Zeitgeschichte werden da schon mal verpennt. Die Anderen sind dadurch sozusagen das Extrem des Reaktionären. Sie hängen an den unkomplizierten alten Zeiten, als es noch schmutzig zuging und es keine Kameras gab, die das nächtliche Menschenmahl für YouTube festhielten.
Vampire und andere Musterbeispiele an Anpassungsfähigkeit
Seltsamerweise fällt es aber ausgerechnet den Kreaturen der Nacht – Figuren wie Bathory, Lestat oder unzähligen Romantasy-Vampiren bis hin zum Glitzerexemplar – am leichtesten, sich die Gegenwart zueigen zu machen. Seltsam deshalb, weil die Nacht die ultimative Verkörperung des Anderen darstellt. Sie ist die Zeit der Dunkelheit und der Träume. Eine jenseitige Periode, traditionell mit einem latenten Gefühl der Furcht und der Erinnerung an Vergangenes verbunden. Doch inzwischen hat der Mensch die Nacht enttabuisiert, ihre Gefahren zu einer Aneinanderreihung hedonistischer Verlockungen erklärt – was den Nachtwesen nur in die Hände spielt.
Zudem rekrutieren sich die Wiedergänger, die Klassiker der Nachtwesen, ständig aus Menschen der jeweiligen Epoche, was die Anpassung natürlich leichter macht und eigentlich eine extrem synkretistische Vampirkultur ergeben müsste. Daher vielleicht auch das traditionelle Verbandeln mit der Gothicszene, welche in ihrer romantisierenden Nostalgie eine Heimat für verwirrte Nachtwesen abgibt, die sich erst mal akklimatisieren müssen.*
Lieber fliegende Städte als fahrende Autos
Andere Feenwesen tun sich da schwerer. Selbst die Zauberer aus „Harry Potter“ haben offenbar noch nie eine Muggel-Einkaufsstraße von innen gesehen, und die Seelie aus Matthew Sturges‘ „Midwinter“ reagieren auf Autos nicht eben begeistert. Fliegende Städte gehen ja noch klar, aber ein Cabrio ist dann doch zu viel des Guten. Die Anderwelten sind ohnehin gegen solch schändliche Technik gefeilt: In „Bannsänger“ etwa wird jede Technik beim Eintritt in die andere Welt in eine magische Entsprechung umgewandelt, in „Roter Mond und schwarzer Berg“ passt sich sogar das menschliche Denken dem der neuen Welt an.
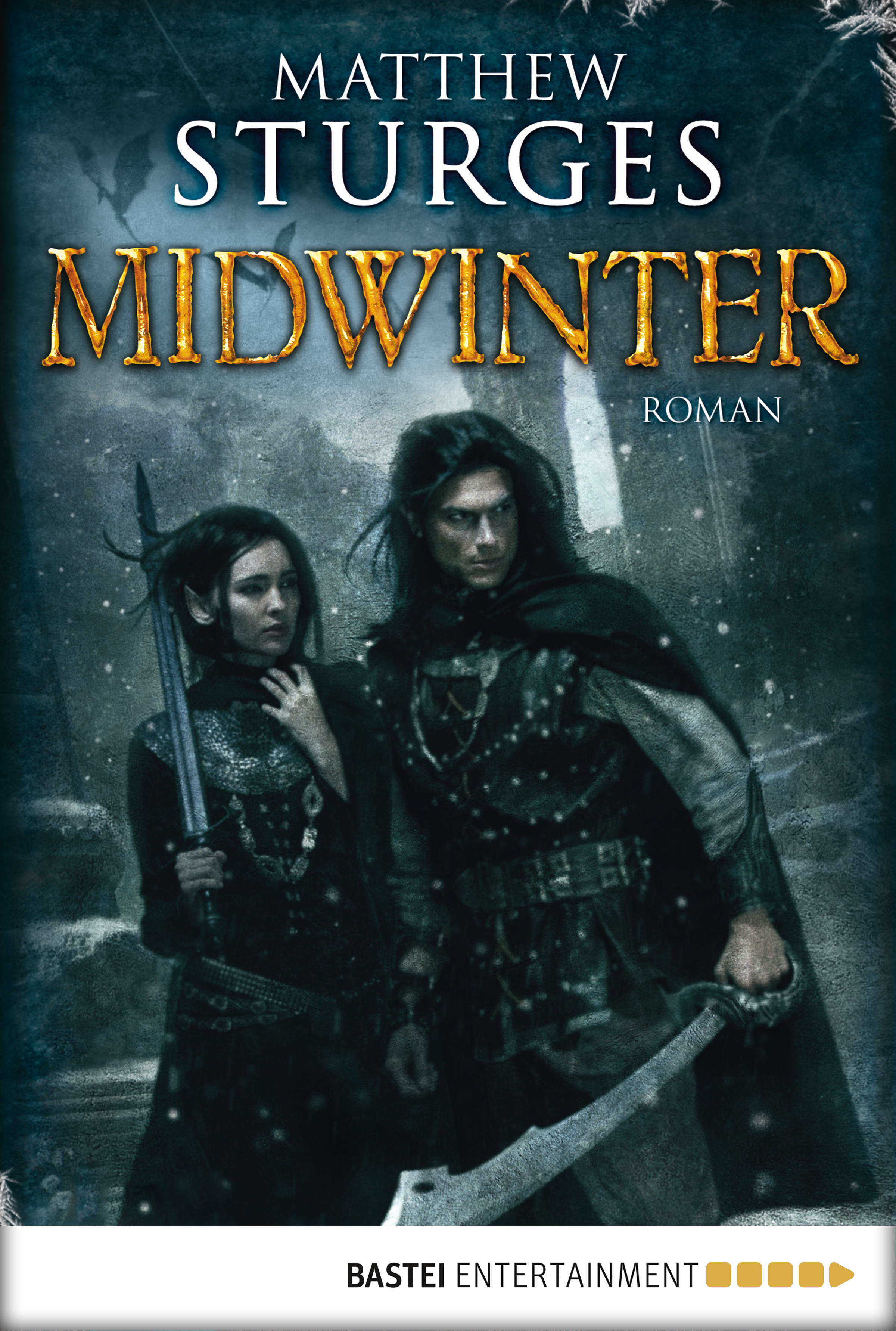
Midwinter ©Bastei Lübbe
Interkulturelle Jugend-Utopien
Am anpassungsfähigsten zeigt sich das Andere noch in der Jugendfantasy, wo jahrhundertealte Feen, Vampire und Co. die Vorzüge der Generationen X bis Z durchaus zu schätzen wissen. Das vielleicht extremste Beispiel dafür ist die „Faeriewalker“-Reihe: Im von Menschen wie Feen bewohnten Avalon haben sich längst auch Victoria’s Secret und Starbucks angesiedelt, und die meisten jungen Feen bevorzugen die Disco gegenüber den durchaus auch vorzufinden Bällen. Ihre Andersartigkeit verlieren die Feen dadurch trotzdem nicht, aber sie haben sich als eine Art kulturelle Minderheit in die britisch-avalon’sche Menschenwelt integriert. Die Feen-Teehäuser und Troll-Bäckereien stehen eben gleichberechtigt neben pakistanischen Restaurants, schottischen Pubs und italienischen Eiscafés.
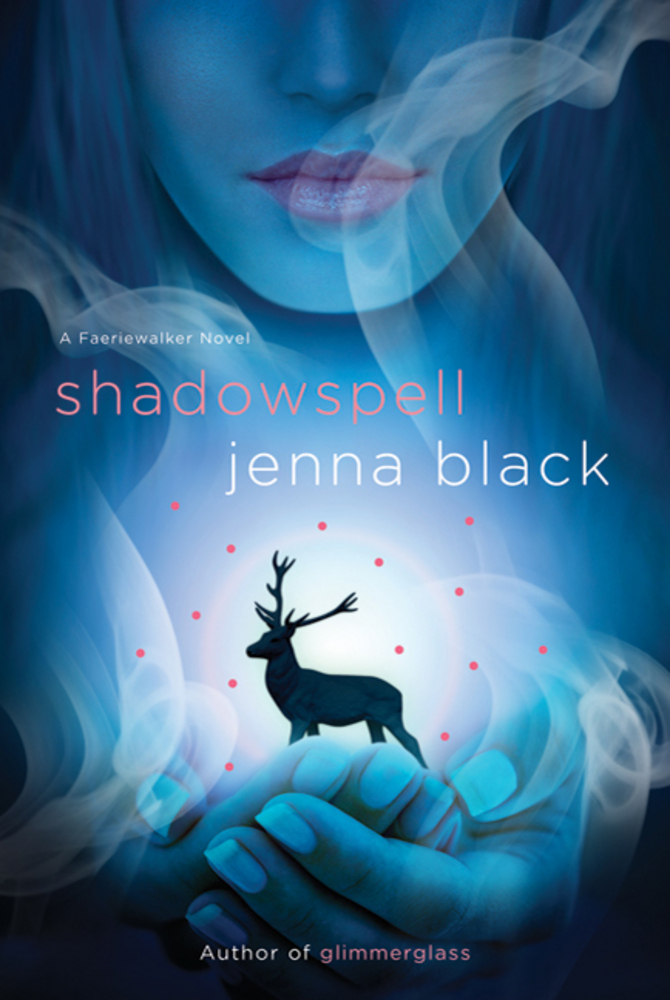
Faeriewalker 2: Shadowspell
© Macmillan (US)
Die Traditionen werden auf den erwähnten Bällen gepflegt, aber auch in Faerie, sozusagen dem Heimatland all jener Feen, die sich in Avalon, diesem Ideal einer interkulturellen Gemeinschaft, nicht besonderes wohl fühlen.** In Faerie ticken die Uhren also wieder anders, klassischer. Technik funktioniert hier eh nicht und wer in Jeans und T-Shirt an den Hof der Feenköniginnen tritt, riskiert mehr als eine gehobene Augenbraue. Hier sind es dann wiederum die Bewohner Avalons, also die „modernen“, menschlichen Kontakt gewöhnten Feen, die sich den Gepflogenheiten ihrer snobistischen Verwandten anpassen müssen – und das ziemlich kompromisslos. Dennoch findet auch hier ein kultureller Austausch statt, der sich insbesondere in der Architektur zeigt. In Faerie findet man den Burj Khalifa halt ebenfalls beeindruckend. Oder zumindest das Dover Castle.
Abgeschwächtere Varianten solcher Annäherungen finden sich etwa in „Strange Angels“, wo Echtwelt-Kneipen den liminalen Raum bilden, in dem menschliche und anderweltliche Einflüsse zusammenkommen, oder in Herbie Brennans „Faerie Wars“-Romanen.
Keine Pressekonferenz in Mittelerde
Außerhalb der Jugendfantasy sind die Beispiele rarer***, auch wenn etwa in der Urban Fantasy zuweilen die Progressiven und die Reaktionären einander gegenübergestellt werden.**** Doch vor allem da, wo nicht in unserer Welt verweilt wird, bedeutet das Andere fast immer auch das Rückwärtsgewandte – selbst dann, wenn es gar kein Eigenes gibt, das dem Anderen gegenüberstände. Eine Ausnahme ist beispielsweise Steph Swainstons „Castle“-Reihe, in der man statt Roben T-Shirts trägt und zum bevorstehenden Krieg eine Pressekonferenz abgehalten wird. Nur ist das für den geneigten Fantasy-Leser schon wieder so irritierend, dass „Castle“ unter New Weird läuft. Dabei muss das nicht besonders weird sein – es kann einfach eine Möglichkeit sein, einer Welt auf relativ leichte Art neue Impulse zu geben. Natürlich braucht nicht jeder Autor Pressekonferenzen in Anderwelten oder Vampire im Pub einzuführen. Doch es ist eine Möglichkeit, Stereotype leichter zu durchbrechen und der Fantasy eine Ironie zuzugestehen, die ihr nicht schaden kann.
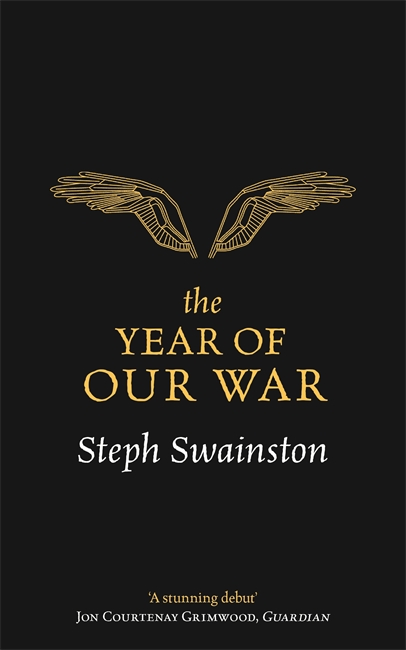
The Year of our war (Castle 1 / dt. Komet)
© Gollancz
* Nüchtern betrachtet hat das wahrscheinlich eher mit dem Ästhetikverständnis einiger Autoren und ihrem Einfluss auf nachfolgende Generationen zu tun, aber das ist halt eine recht profane Sicht.
**Übrigens ist Avalon in dieser Beziehung zu utopisch. Offenbar gibt es keinerlei Konflikte zwischen Menschen und Feen, was bei näherer Betrachtung eine sehr unrealistische Vorstellung gibt.
*** Ich vermute, an dieser Stelle sollte ich auf Neil Gaiman verweisen, aber alles, was ich von ihm gelesen habe, passt da nicht so richtig rein. Ich habe „American Gods“ nicht gelesen …
**** Z. B. in „Die Flüsse von London“. In „Die Chroniken des Eisernen Druiden 1: Gejagt“ dagegen verhalten sich v. a. die Götter wie überholte Trottel. Wieder sind es vor allem die Nachtwesen wie Werwölfe und Vampire, die sich der neuen Zeit anzupassen wissen. (Ja, diese Anmerkung habe ich ein paar Stunden nach VÖ ergänzt, weil mir die Erwähnung dieser Gegenüberstellung noch gefehlt hat. Die Freuden des Bloggens gegenübr der Printveröffentlichung!)
Was mir oft ganz gut gefällt: wenn Fabelwesen sich in Subkulturen niederlassen. Waren das die Southern Vampire Mysteries, in denen Werwölfe sich in Biker-Gangs organisieren? In China Miévilles Kraken und den Peter-Grant-Romanen von Ben Aaronovitch bildet dagegen der magische Untergrund von London selber eine Art Subkultur. Besonders lustig finde ich bei Aaronovitch, dass es die menschlichen Zauberer sind, die der guten alten Zeit hinterher trauern (damals, als Magie noch das Privileg von Gentlemen) war, während die Fabelwesen sich in der Gegenwart ganz gut zurecht finden.
P.S.: Ups, Ergänzung des OP verpasst.
Ja, an genau diese Gegenüberstellung bei Peter Grant musste ich heute Morgen auch denken (leider erst, nachdem der Beitrag schon online war …).
Ist das mit der Bikergang nicht auch in „Lost Boys“? Ich frage mich gerade, ob es abseits des Rock/Metal/Gothic-Bereichs Subkulturen oder Szenen gibt, in denen sich Fabelwesen niederlassen. Hippiefeen wären doch mal was 😉 (Auf Rap-Werwölfe kann ich verzichten.)
[…] über Das reaktionäre Andere in der Contemporary Fantasy … — Fragment Ansichten […]
[…] Das reaktionäre Andere in der Contemporary Fantasy […]
[…] ich mich in den Urban / Contemporary-Gefilden inzwischen wohler fühle, auch wenn wir damit wieder bei deren Clash of Cultures gelandet […]
[…] hierzulande viel im Vorsichtigen und Bekannen verhaftet. Sich das klarzumachen, Neues zu wagen und reaktionäre Muster zu vermeiden, ist insofern keine schlechte […]