Früher war alles anders 6: „Das Licht hinter den Wolken“
„Der wird auch immer kommerzieller.“
Mit diesen Worten kommentierte Samira* vor ca. vier Jahren meine Nachricht, dass der Autor von „Fairwater“ und „Die Magier von Montparnasse“ nun einen High Fantasy-Roman aus seiner Feder angekündigt hatte. Wer sich mal ein bisschen underground** gefühlt hat, weiß natürlich, was der Satz bedeutete: Der Autor war ein Verräter. Da hatte er zwei so schöne Romane geschrieben.*** Das eine ein poetischer Blick auf ein magisches Paris,**** linguistisch und perspektivisch abwechslunsgreich. Und das andere – hach, postmodern, nicht chronologisch und so dark and depressive, dass man denken könnte, Oliver Plaschka sei Russe. Durchaus also Bücher, mit denen man sich sehen lassen konnte.
Musste es denn High Fantasy sein?
Und dann High Fantasy. Kommerz-Genre. Schönes Genre, aber – Kommerz. Klar konnteste mal „Drachenlanze“ lesen und „Der Herr der Ringe“ eh. Aber danach musstest du mindestens einen Aufsatz über Rassismus in der Fantasy schreiben, um den schwarzen Rollkragenpulli wieder mit Würde tragen zu können. Nee, also was sollte da als nächstes kommen – ein Historienroman?
Na ja, aber leider war ich schon zu addicted*****, um das Buch wegen seinem Genre nicht zu lesen und überhaupt wurde ich wohl langsam alt, also kam in die Phase, in der ich … in meinen Ansichten differenzierter wurde oder so’n Zeug. Also hab ich’s gelesen und danach ist auf meinem alten Blog eine echt rührselige Besprechung erschienen, die ich offenbar nicht offline gespeichert habe. Wahrscheinlich ganz gut so.
Wir mögen das, aber warum heulen wir dabei?
Tatsache ist jedenfalls: Ist’n gutes Buch. Ich suche einen Vergleich, aber mir fällt kein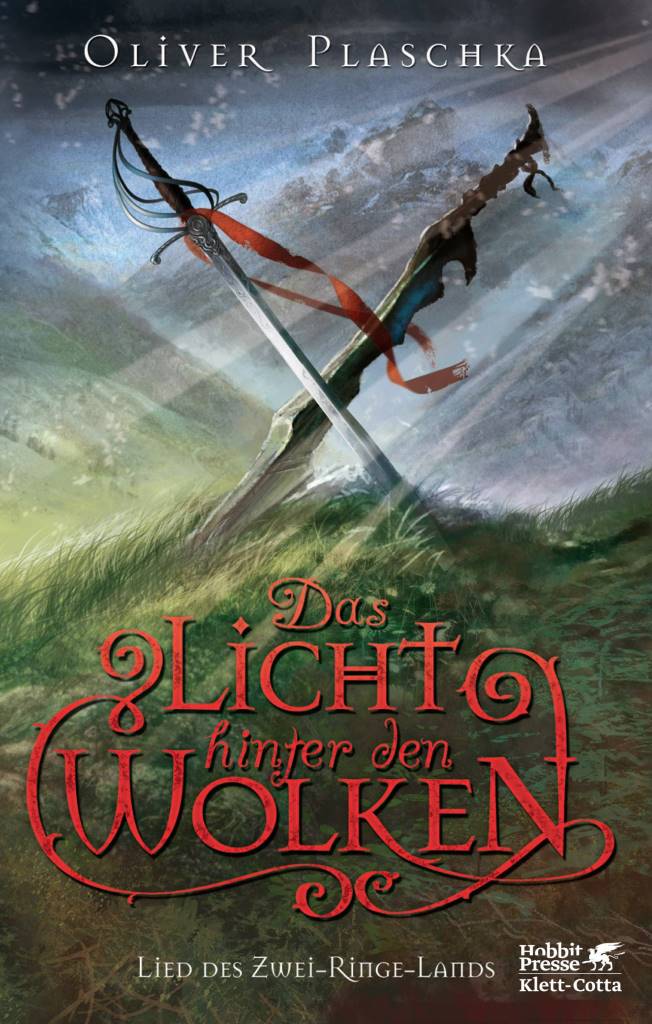 zufriedenstellender ein. Oder … kennt ihr „Lux Aeterna“ von Clint Mansell? Das Lied aus „Requiem for a dream“, der Soundtrack zum Sterben, hört es euch an. Stellt euch das Lied als Buch vor. Dann habt ihr „Nesaja“, eines der schönsten und schmerzhaftesten Kapitel, das ich je gelesen habe. Packt ein Gemälde von H. R. Giger dazu, dann habt ihr das zweitschönste Kapitel, „Sariks Versuchung“. Wenn euch das alles zu depressiv wird, nehmt etwas Pratchett, aber von seinem späten, melancholischen Zeug, mit dem nachdenklicheren Humor. Und dann guckt euch toskanische Landschaften an. Ein bisschen Road Movie dazu, ein wenig den schicksalhaften Stoismus eines Laurent Gaudé und irgendetwas Absurdes, aber auch schillernde Lichter, die Stimmung von „The Fall“ und vielleicht einen Hauch der Visionsszenen aus „Avengers 2: Age of Ultron“. Nehmt all das, steckt es in einen Mixer und genießt „Das Licht hinter den Wolken“.
zufriedenstellender ein. Oder … kennt ihr „Lux Aeterna“ von Clint Mansell? Das Lied aus „Requiem for a dream“, der Soundtrack zum Sterben, hört es euch an. Stellt euch das Lied als Buch vor. Dann habt ihr „Nesaja“, eines der schönsten und schmerzhaftesten Kapitel, das ich je gelesen habe. Packt ein Gemälde von H. R. Giger dazu, dann habt ihr das zweitschönste Kapitel, „Sariks Versuchung“. Wenn euch das alles zu depressiv wird, nehmt etwas Pratchett, aber von seinem späten, melancholischen Zeug, mit dem nachdenklicheren Humor. Und dann guckt euch toskanische Landschaften an. Ein bisschen Road Movie dazu, ein wenig den schicksalhaften Stoismus eines Laurent Gaudé und irgendetwas Absurdes, aber auch schillernde Lichter, die Stimmung von „The Fall“ und vielleicht einen Hauch der Visionsszenen aus „Avengers 2: Age of Ultron“. Nehmt all das, steckt es in einen Mixer und genießt „Das Licht hinter den Wolken“.
Danach könnt ihr den nachfolgenden Text lesen, in dem Oliver Plaschka das eine oder andere zur Entstehung des Buchs erzählt. Mehr aus diesem Themenbereich findet ihr hier. Wer sich für so etwas Profanes wie den Inhalt des Romans interessiert, wird z. B. hier fündig.
Alles ist verbunden: „Das Licht hinter den Wolken“
„Das Licht hinter den Wolken“ entstand im Gegensatz zu meinen anderen Romanen aus teils 20 Jahre alten Notizen und Ideensammlungen; das heißt, dass ich einerseits bereits vor Arbeitsbeginn sehr klare Vorstellungen vom Stoff hatte und vergleichsweise wenig spontan übers Knie brach; andererseits gab es auch Gründe, weshalb es mir als jungem Autor nicht gelang, diesen Stoff umzusetzen. Einer davon war, dass ich mir lange nicht sicher war, wie die Welt des Romans eigentlich aussehen sollte, und wie genau die Einzelschicksale der sehr verschiedenen Figuren miteinander verwoben sein sollten. Selbst Nebenfiguren wie Iason, Percill, Krayn, Zeona, Korianthe und Ycille spukten unten anderen Namen schon durch diese Notizen, inklusive der vielen Geschichten-in-der-Geschichte (wie die der Prinzessin, von Iladas, oder Sariks Vorgeschichte), was es nicht einfacher machte.
Von Navylyn bis Schneeweiß
In den frühesten Fragmenten war daher häufig von „zehntausendundeiner Welt“ die Rede, die alle miteinander verbunden waren. Sarik begann seine Reise, nachdem er den Blauen Wald verließ, durch ein ganzes Multiversum fantastischer Welten (mit Navylyn als der 10001.), in denen er teilweise auch andere Erscheinungsformen annahm. Natürlich habe ich mich dadurch hoffnungslos verzettelt und diesen Handlungsstrang irgendwann abgebrochen.
Sarik selbst hat, wenn man so will, denselben Vater wie Ravi aus den „Magiern von Montparnasse“: ein Zauberer in blauer Klamotte, der mit einem wohlmeinenden Geistwesen in Kontakt steht. Ursprünglich eine Pygmalionfigur aus einer langjährigen Shadowrun-Kampagne, erschuf er einen Ally namens „Snowwhite“; daraus wurde — mit umgekehrten Vorzeichen — Blanche aus  den „Magiern“, aber auch — anders angelegt und verniedlicht — das Irrlicht Schneeweiß.
den „Magiern“, aber auch — anders angelegt und verniedlicht — das Irrlicht Schneeweiß.
Ich wusste immer, dass das Irrlicht zum Finale des Romans, als es in die Hallen von Navylyn eindringt, eine entscheidende Rolle spielen würde. Zunächst war es aber nicht mehr als ein harmloser Sidekick. Dass es auch eine innerfiktionale Begründung dafür geben muss, weshalb das Irrlicht das tun kann, was es tut, wurde mir erst im Verlauf des Schreibens klar. Ergebnis war, dass Schneeweiß sehr viel zentraler für den ganzen Plot wurde.
Von Echsen und Engeln
Umgekehrt verhält es sich mit den Wechselbälgern, die anfangs deutlich regelverliebter angelegt waren. So spielte es beispielsweise eine Rolle, zu welcher Tageszeit ein Opfer von einem Wechselbalg infiziert wurde. Starb es bei Tag, konnte es auch nur bei Tag seine neue Gestalt annehmen, und umgekehrt bei Nacht. Für den Plot des Romans war das unnötig kompliziert.
Lange mochte ich mich auch nicht festlegen, was für Kulturen bzw. „Völker“ es auf der Welt gab. Gerade an Cassiopeias Familienverhältnissen bastelte ich unglaublich lange. Mir war klar, dass sie eine Art „Halbelfin“ sein sollte, aber wie und was genau und ob jetzt Vater oder Mutter etwas Besonderes waren, das brauchte eine Weile. In grauer Vergangenheit (auch Cassiopeias Ausbildung zur Kriegerin hat Wurzeln im Rollenspiel) gab es auf der Insel der Krieger auch Echsenwesen. Die „Wesenheiten“ wurden in einer alten Fassung tatsächlich als „Engel“ bezeichnet, was insbesondere der Endschlacht eine noch biblischere Dimension gab. Auch Lyora (Zearis‘ Mutter) war damals eine der „Angeloi“.
Von Schwächen und Stärken
Janner war von vornherein als Trickster angelegt, beeinflusst nicht zuletzt von den Romanzen James Branch Cabells, was man vor allem in seiner Vorgeschichte merkt. Nur verschmitzt und souverän war aber irgendwann zu wenig, er brauchte auch einen klaren Charakterfehler (außer, dass er sich ständig etwas vormacht – dies ist im Kontext des Buchs tatsächlich sogar eine Stärke). Ich merkte beim Schreiben, dass er für mich umso besser funktionierte, je mehr er trank. So wurde meine männliche Hauptrolle im Laufe des Romans zum Alkoholiker, und April durfte ihn gelegentlich zu retten versuchen.
April ist die Figur, die sich für mich am wenigsten verändert hat und mit der ich eigentlich auch stets recht glücklich war, was etwas schade ist, weil manche Leser nicht mit ihr warm wurden. Selten habe ich so klar gemerkt, dass Romanfiguren anders funktionieren als Figuren im Film; ich bin davon überzeugt, dass sie in einem Spielfilm oder einer Serie einen leichteren Stand gehabt hätte.
Von Gewinn und Verlust
Auch an der Struktur des Buchs habe ich lange gefeilt: Einige Passagen wurden mehrmals auf Gegenwart, dann wieder auf Rückblende umgeschrieben, was man den relativ langen und kompliziert aufgebauten ersten beiden Kapiteln noch ansieht. Einige etwas zu psychedelische Passagen aus den alten Fragmenten ließen sich nicht sinnvoll umsetzen, dafür geriet Sariks Ausflug zu Ycille und Cenaldi überraschend düster. Es gab Gespräche mit dem Verlag, ob man dieses Kapitel nicht streichen sollte, aber ich bin froh, dass es noch drin ist; ich hätte auch nicht gewusst, wo ich die vielen Hintergrundinformationen sonst unterbringen sollte. Ab dem siebten Kapitel lief dann wieder alles so, wie es immer geplant war, inklusive einiger Wendungen, mit denen ebenfalls nicht alle Leser glücklich waren. Aber ich bin der Ansicht, dass man am Ende einer Geschichte immer gleichermaßen etwas gewonnen wie etwas verloren haben sollte. Die Geschichten, die mich persönlich am meisten berühren, sind die, bei denen ich nicht weiß, ob ich mich freuen oder weinen soll. Das ist für mich beim Schreiben meine Messlatte.
„Das Licht hinter den Wolken“ von Oliver Plaschka, Klett-Cotta (2013), ISBN: 978-3-608-93916-3 (Hardcover) / Klett-Cotta 2016, ISBN-978-3608-96138-6 (Taschenbuch)
* Name von der Redaktion geändert.
** Ich habe diesen Begriff schon verwendet, bevor er cool wurde. Ebenso wie indie. Das alte indie, nicht das Selfpublisher-Indie.
** Eigentlich drei. Aber „Der Kristallpalast“ war selbst für uns zu underground.
*** Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von Paris. Vielleicht war ich zum falschen Zeitpunkt dort, vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch oder vielleicht ist es auch einfach nicht mein Ding. So oder so – Real Life-Paris ist nicht unter meiner Top Ten der anbetungswürdigsten Städte. Aber irgendwie verzaubert es ja seit Jahrhunderten die Autoren und dieses Medien-Paris, vor allem das phantastische, ist immer wieder eine Reise wert. (Gibt übrigens auch Städte, die ich im RL atmosphärischer finde als in Bücher, Filmen und Co. Vor allem Italienische. Jeder meint, etwas schreiben zu müssen, was dort spielt, aber ich habe noch selten ein Buch gelesen bzw. einen Film geguckt, der „mein“ italienisches Flair wirklich eingefangen hätte. Da geht’s immer nur um Lebensfreude und Spaghetti. Aber sowohl bei Paris als auch bei Italien hat Woody Allen die Messlatte schon recht hoch gelegt. War allerdings auch noch nie in Rom.)
**** Ich weiß auch nicht, was das mit den ganzen englischen Wörtern heute soll.
[…] zu lesen.** Viele habe ich zum zweiten, dritten oder sechsten Mal gelesen, beispielsweise „Das Licht hinter den Wolken„, „Phantasmen“, „Faeriewalker“ oder „Die Tribute von […]
[…] mich) dennoch begleitet – Beispiele dafür sind „Der Kinderdieb“ von Brom oder „Das Licht hinter den Wolken“ von Oliver Plaschka. Die folgenden Beispiele sind Mitteldinger, oder, positiver […]
[…] Früher war alles anders 6 […]
[…] Patricia A. McKillip, einer meiner Pratchett-Lieblingsromane („Kleine freie Männer“) und auch Oliver Plaschkas „Das Licht hinter den Wolken“ es auf die Liste geschafft haben. Bei ein paar anderen Titeln […]
[…] der Titel der Verfilmung von 2012 ist). Übersetzt wurde die Neuveröffentlichung übrigens von Oliver Plaschka, die Buchwelt ist ja klein. Das andere ist ein Zeitreise-Kurzroman aus dem Jahr 2019, auch bekannt […]
[…] das natürlich nie wirklich endet. Aktuell lese ich z. B. „Der Kristallpalast“ von Oliver Plaschka, Alexander Flory und Matthias Mösch und höre Anika Beers „Succession Game“, werde […]
[…] eine Origin-Story zum Besten geben. Thilo, von dem hat damals eine Schulfreundin im Park erzählt. Olivers Debüt habe ich zu Unizeiten auseinandergenommen. Anika habe ich vor Jahren über den Tintenzirkel […]