Heute Idealist, morgen Kapitalist? Der Hybridautor
[Untertitel: Verdammt, ich wollte mich doch aus den Modell-Diskussionen heraushalten!]
Wie man in den letzten Wochen wieder eindrucksvoll bezeugen konnte, ist die deutschsprachige Phantastik-Autorenschaft in drei scheinbar unvereinbare Lager geteilt. So geschlossen sie auch eintritt, wenn ihr jemand blinden Eskapismus vorwirft, so verbittert verteidigt sie nach innen die Werte ihres jeweiligen Veröffentlichungsmodells: Publikums- und Kleinverlagsautoren sowie Selfpublisher batteln sich weiterhin munter um die Frage, wer die coolste Gans am Hofe ist.
Auf den ersten Blick gebührt diese Rolle natürlich den in der Regel von Agenturen unterstützten Publikumsverlagsautoren, die ohnehin höchstens mit einem milden Lächeln auf ihre Kollegen ohne Buchhandelspräsenz hinabblicken. Falls die Ökonomie der Phantasten irgendwo eine Chance hat, nicht nur um sich selbst zu kreisen, dann hier. Andererseits sind die PV-Autoren ja ausnahmslos furchtbar elitäre Kapitalisten, die die Kunst an den Kommerz verraten haben. So zumindest die Meinung aus den Indie-Kreisen der extrem innovativen KV-Autoren und Selfpublisher, die zwar nach PVler-Annahme nichts verkaufen und keine Qualitätsansprüche haben, dafür aber hohe Kunst abseits des Mainstreams(TM) produzieren. Allerdings ist man sich auch hier spinnefeind – schließlich sind Kleinverlagsbücher schlecht geschrieben (so sagen die Selfpublisher) und Selfpublisher-Romane eine Zumutung (so sagen die Kleinverlagsautoren). Dafür weiß man unter KV-Autoren noch, was echte Kameradschaft ist und Selfpublisher sind wahre Allround-Talente.
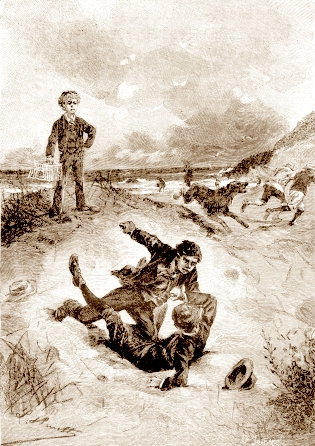
Was dieser extrem differenzierte und überhaupt nicht verallgemeinernde Absatz ausdrücken soll: Im Jahr 2016 stehen dem ernstzunehmendem Autor drei verschiedene Modelle zur Veröffentlichung zur Wahl. Welche er zunächst wählt, ist in erster Linie wahrscheinlich von den Rädern des Schicksals abhängig, in zweiter vom persönlichen Geschmack. Nicht selten bleibt es dann bei diesem Modell – vielleicht, weil man eben davon überzeugt ist, vielleicht auch, weil einem die Möglichkeit zum Wechsel verwehrt bleibt. Dabei bietet jedes Modell sowol Vor-, als auch Nachteile, wodurch meines Erachtens keines wirklich als „besser“ oder „schlechter“ gegenüber den anderen angesehen werden werden kann.*
Als Ideal sollte daher stattdessen eine vierte Alternative gesehen werden, die beispielsweise Ende 2015 von der US-amerikanischen Autorin Gail Z. Martin in den Ring geworfen wurde: der Hybridautor (hybrid writer). Dieser ominöse Kerl macht sich nichts aus dem Image, das mit der einen oder anderen Veröffentlichungsform einhergeht. Stattdessen wählt er alle drei, um die jeweiligen Vorteile für sich zu nutzen. Im Falle der Publikumsverlage (big publishers) bedeutet das (hoffentlich) Sichtbarkeit, Bekanntheit und normalerweise den höchsten finanziellen Ertrag**. Kleinverlage (small press) dagegen bieten Mut zur Nische, gepaart mit den üblichen Verlagsvorzügen (Lektoren, Coverdesigner, eine gewisse Qualitätsbestätigung – „yay, jemand hat Vertrauen in mein Manuskript!“). Die ultimative Unabhängigkeit aber verspricht das Selfpublishing.
In Bezug auf Letzteres macht Martin vor allem auf die Möglichkeiten von Verlagsautoren aufmerksam, ältere Werke neu aufzulegen oder Reihen zu vollenden bzw. auszuweiten. So verstanden, sind die Beispiele von Hybridautoren aus dem englischsprachigen Raum zahlreich. Man denke etwa an Kenneth C. Flint, der nach Ausflügen in Verlage unterschiedlicher Größe in der Vergessenheit versank, ehe er seine Romane als E-Books neu auf den Markt brachte und sogar die „Riders of the Sidhe“-Reihe fortzuführen begann. Oder an Jenna Black, die das Selfpublishing nutzt, um Spin off-Novellen zu ihren erfolgreichen YA-Reihen zu veröffentlichen.
Im deutschsprachigen Raum gibt es solche Autoren durchaus auch, wobei der zweigleisige Weg dominiert: Thomas Elbel hat seinen dritten Sci Fi-Thriller „Megapolis“ nicht wie dessen Vorgänger bei Piper, sondern im Selfpublishing herausgebracht, Cornelia Funke gleich einen englischsprachigen Eigenverlag gegründet, Susanne Pavlovic switcht zwischen Kleinverlag und Selfpublishing, Autoren wie Oliver Plaschka oder Sabrina Železný wiederum zwischen Publikums- und Kleinverlagen. Ein Modelltriptychon lässt sich beispielsweise bei Thilo Corzilius oder Kai Meyer finden: Beide dürften derzeit zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Publikumsverlagsautoren in Sachen Fantasy gehören, haben aber auch (kürzere) Ausflüge ins Selfpublishing unternommen sowie Werke bei unabhängigen Kleinverlagen herausgebracht. Zum Teil wird bei diesen Beispielen auch ein weiterer Aspekt deutlich, der für die Veröffentlichungshybridisierung spricht: Man kann sich ausprobieren. Ein PV-Fantasyautor kann via Selfpublishing Krimis veröffentlichen, eine PV-Historienautorin Kleinverlage für phantastische Werke nutzen.
Natürlich klingt das jetzt alles sehr einfach und missachtet ein paar Hindernisse, die dem geneigten Hybridschreiber in den Weg gelegt werden können. Etwa, dass es manchen Autoren durch Verträge verboten ist, mehrgleisig zu fahren oder dass es aus praktischen Gründen nicht unbedingt jedem möglich ist. Nach wie vor muss man Agenturen oder Verlage schließlich erst einmal von sich überzeugen. Und auch der Weg der Selfpublisher ist nicht für jeden etwas – manch einer droht schon an Covererstellung oder Satz zu scheitern.
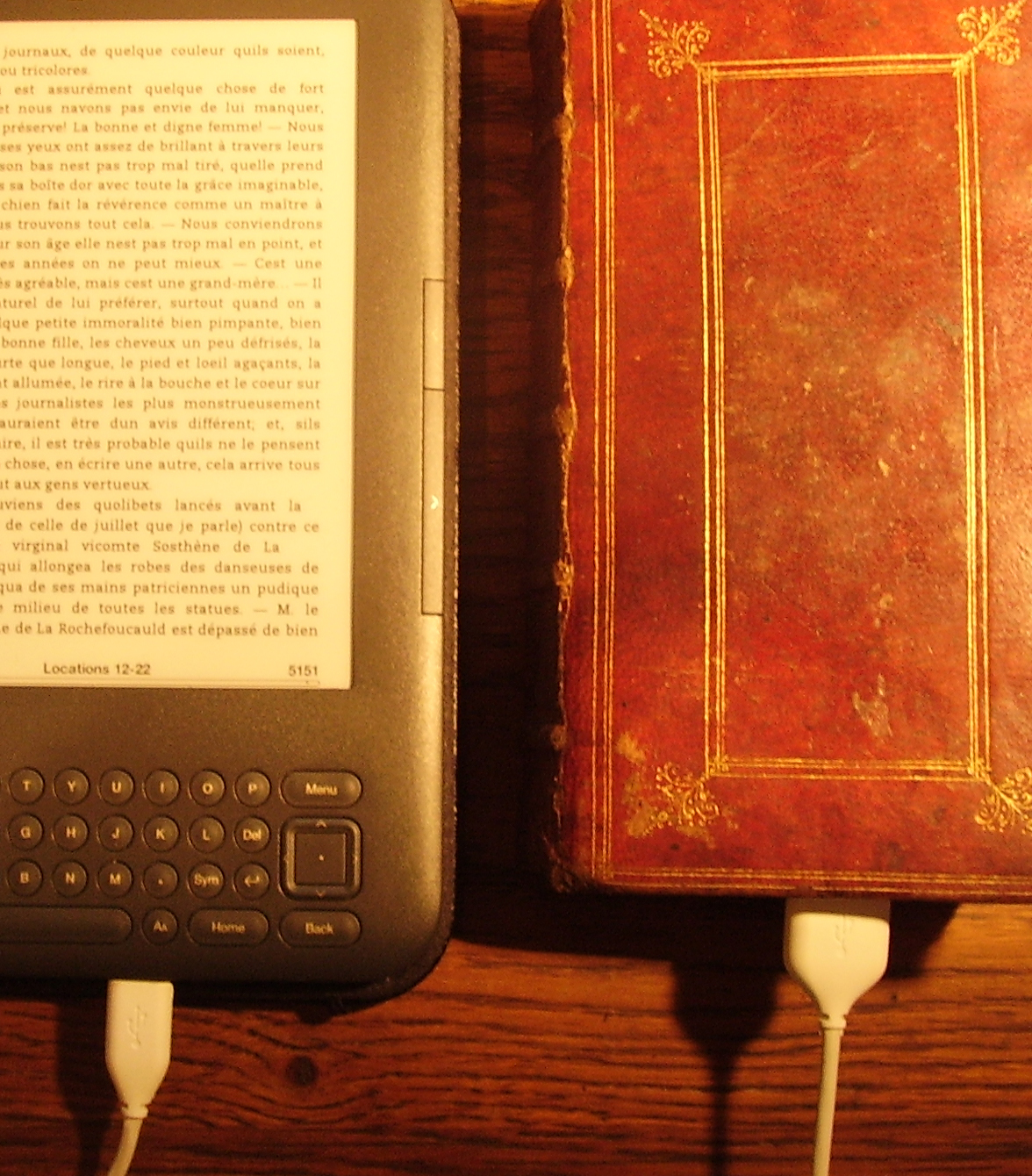
Dennoch habe ich den Eindruck, dass es in vielen Fällen nicht mangelnde Chance ist, sondern eine Form von Ideologie, die die Fronten zwischen den „Modellautoren“ lieber verhärtet, anstatt die Vorteile aller drei Möglichkeiten wahrzunehmen. Vielleicht ist es auch eine Frage der Branche insgesamt, die nur langsam akzeptiert, dass sie Veränderungen ausgesetzt ist. Es ist noch nicht soo lange her, als mir davon abgeraten wurde, jemals etwas über BoD herauszubringen – nicht, weil das betreffende Buch dann für Verlage auf ewig verbrannt wäre, sondern weil mich dann kein Verlag je mehr mit irgendeinem Buch aufnehmen würde. Und selbst, als „Vor meiner Ewigkeit“ im Kleinverlag veröffentlicht wurde, sagte mir jemand, meine Chance sei damit dahin, jemals bei einem Publikumsverlag zu landen. Nun, ich denke, es gibt inzwischen genug Gegenbeispiele von Hybridautoren, um das nicht allzu ernst zu nehmen. Trotzdem bleibt immer ein gewisses Misstrauen gegenüber „den anderen“.
Anderen Branchen ist dieses Misstrauen offenbar durchaus fremder. Vor ein paar Wochen habe ich in einem ganz anderen Kontext eine Mangaka interviewt, die schon so ziemlich jede Form von Verlagsveröffentlichung und Selfpublishing hinter sich hat. Ich war einigermaßen verwirrt davon, dass sie Nachwuchskünstlern explizit geraten hat, sich erst einmal als Selfpublisher zu versuchen. Sie war wiederum von meiner Überraschung verwirrt und meinte sinngemäß, man müsse doch schließlich erst einmal ausprobieren, ob man veröffentlichen kann, bevor man von einem Verlag überhaupt ernstgenommen wird. Ich kann diese Meinung nicht so recht teilen, da ich es mir ohne Verlagserfahrung schwierig vorstelle, in allen Bereichen von Lektorat bis Marketing einen auch nur groben Durchblick zu erhalten. Andererseits – ihre Sichtweise hat auch was.
–
*Das gilt natürlich nur, wenn jeweils das Optimum aus der Option herausgeholt wird.
** Ja ja, ich weiß, dass es auch wahnsinnig erfolgreiche Selfpublisher und Tannennadeln kauende Publikumsverlagsautoren gibt.
Edit: In der ersten Version war vom „Hybridschreiber“ die Rede. Das klang mir dann aber doch zu sehr hiernach.
[Text unter CC BY-ND 3.0 DE]
4 Gedanken zu „Heute Idealist, morgen Kapitalist? Der Hybridautor“
Ich weiß nicht wie es im Fantastikbereich ist, aber in der so genannten „mainstream-“ oder gar „ernsten“ Literatur scheint mir der Wechsel aus dem Selfpublishing oder Kleinverlagsbereich in einen großen Verlag auch aus Dünkelgründen sehr schwierig. Der Weg nach einem Erfolg sich unabhängig zu machen dagegen noch (vergleichsweise) einfach zu bewerkstelligen. Das geht ja sogar soweit, dass Hildesheimer und Bieler StudentInnen allem Anschein nach noch ohne eigene Veröffentlichung zum Bachmannpreis geladen werden…
Dünkel spielen da sicher eine Rolle, auch in der Phantastik.
Aber die Anspielung mit den StudentInnen versteh ich nicht … ?
sollte gar keine dunkle Anspielung sein. Meine zugegeben nicht umfassende Recherche vor kurzem ergab, dass zum Bachmannpreis halt gar nicht so selten junge Autoren praktisch ohne Veröffentlichung geladen werden (von Rönne, wenn ich es richtig verstehe, hat sogar ihren Text erst nach der Einladung geschrieben?), und da handelt es sich dann eben meist um SchülerInnen der wenigen renommierten Literaturinstitute (die allein dadurch, dass man sie kennen muss um sich zu bewerben und dass man sich einen solchen „brotlosen“ Studiengang muss leisten können natürlich nochmal sehr stark sozial selektieren, aber das ist ein anderes Thema)