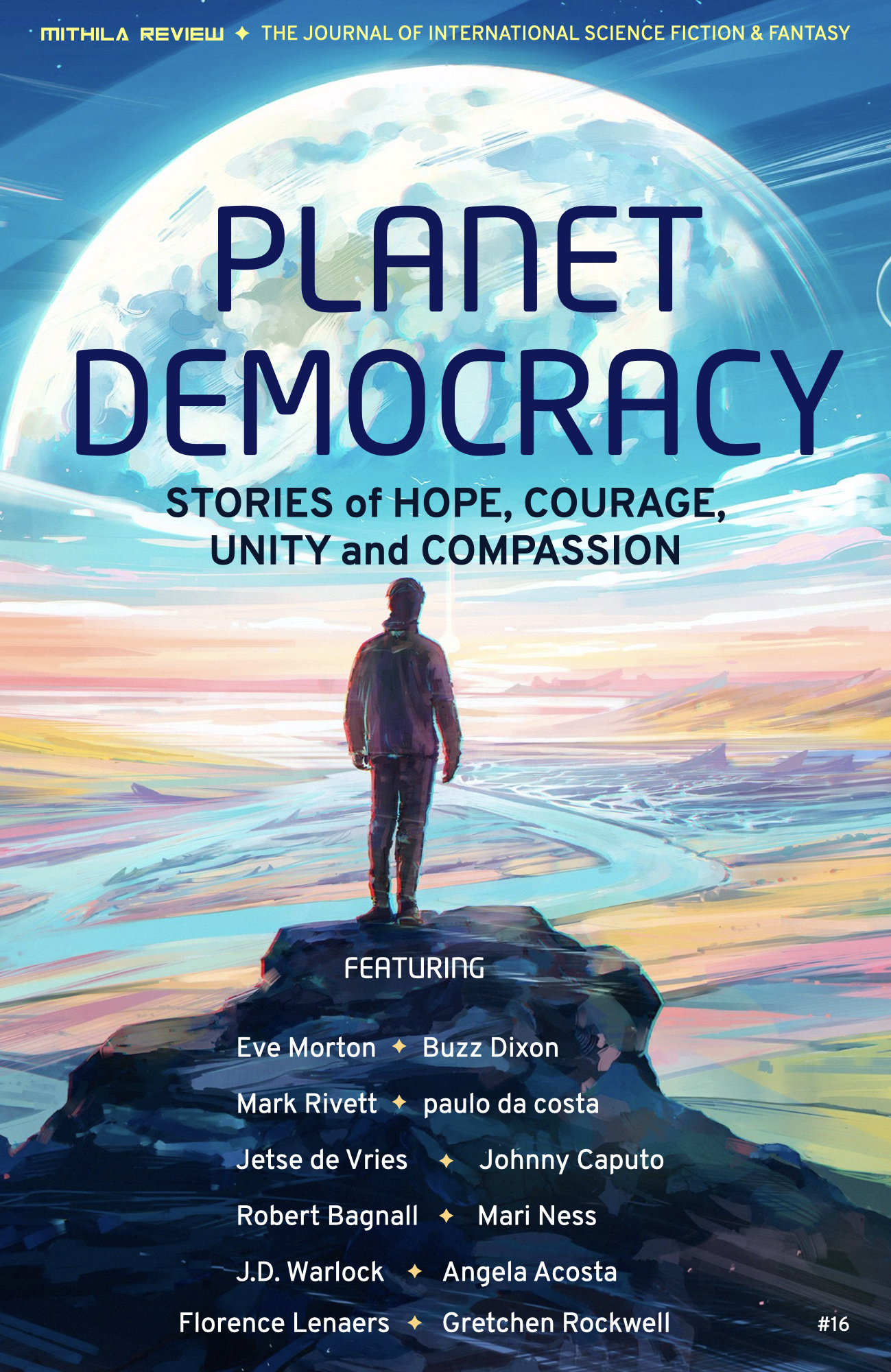
Hopepunk 2022 / Planet Democracy
Hopepunk damals und heute + eine Besprechung zur „Planet Democracy“-Themenausgabe der Mithila Review
(1) 5 Jahre Hopepunk
Die Sache mit den Monatsansichten hat den Vorteil, dass ich bei einigen Begriffen gut nachvollziehen kann, wo bzw. wann ich ihnen das erste Mal substantiell begegnet bin. Im Falle von Hopepunk müsste das im Januar 2019 gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Einjähriges gefeiert und interessanterweise entdeckten ihn im englischsprachigen Raum gerade Lifestyle-Magazine, die Hopepunk in die Nähe von Selfcare von JOMO rückten.
Hierzulande kam er erst ein paar Wochen später an, dann aber mit bemerkenswertem Impact. Kaum ein Monat, in dem damals nicht auf Twitter die unvermeidliche Diskussion aufbrandete, ob es sich nun um ein Genre handle und was das Punk-Suffix denn solle. Dass der Begriff überhaupt die Runde machte, lag zum einen daran, dass er einen Nerv traf und sich dabei in mehrfacher Hinsicht durchlässiger gab als z. B. der (das?) vergleichbare Noblebright. Zum anderen wurde seine Besprechung im deutschsprachigen Raum dadurch befeuert, dass im September 2019 mit „Wasteland“ von Judith und Christian Vogt der erste (hierzulande) gezielt als Hopepunk vermarktete Roman erschien und beide den Begriff u. a. über Blogbeiträge und einen Podcast stark in Umlauf brachten.* Von mir wiederum gab’s einen Artikel für TOR Online, 2020 entdeckten das Thema dann u. a. der Deutschlandfunk und Kulturzeit, im Januar 2020 veröffentlichte außerdem Heike Lindhold via Teilzeithelden.de einen sehr umfassenden Blick auf den damaligen Status quo.
Und heute? Ist der Hopepunk ausreichend etabliert, dass wir die Grundsatzdiskussionen hinter uns gelassen haben. Dennoch bleibt er nebulös und es existieren – wie das bei vielen Subgenres u. Ä. der Fall ist – mehrere Ansichten darüber parallel, was Hopepunk denn nun sein soll. Für viele handelt es sich, bedingt durch mehrere prominente Beispiele, vornehmlich um postapokalpytische oder dystopische Literatur mit einem Element widerständiger Hoffnung – eine durchaus großzügige Auslegung. Für andere, mich z. B., sind Dystopie und generell Phantastik zweitrangig, wichtiger sind eine episodenhafte Struktur sowie der Wille zur Versöhnung und Zusammenarbeit gegen ~größere Übel als Handlungselement. Für wieder andere steht eine gewisse wholesomeness im Vordergrund, zentral sind außerdem in wohl allen Auffassungen Community-Ideal und Diversity-Bewusstsein. Viele dieser Elemente sind aber keineswegs Hopepunk-exklusiv: wer es cozy und wholesome mag, fühlt sich vielleicht auch im Cottagecore wohl. Und Community, Diversity, eine gewisse Episodenhaftigkeit sowie ein oft postapokalyptisches Setting haben wir ebenso im Solarpunk, insbesondere im Post-2018-Solarpunk, der ohnehin starke Überschneidungen zum Hopepunk aufweist und ihm 2020/2021 den Rang abgelaufen hat. Hierzulande sollte außerdem das Movement der Progressiven Phantastik nicht unerwähnt bleiben, das sich in Teilen aus den Hopepunk-Diskussionen heraus entwickelt hat und ähnliche Werte vertritt.
Unschärfen bleiben also bestehen, der Hopepunk aber auch. Kurzgeschichten und Romane werden immer mal wieder (v. a. von Autorenseite) mit dem Begriff beworben. Inzwischen hat er sogar den Schritt rüber in die Musik gewagt (siehe die Band Sündflut), und mit „Everything everywhere all at once“ ist dieses Jahr ein Film erschienen, der meines Erwachtens Hopepunk in Reinkultur darstellt.
(2) Hopepunk-Themenausgabe der Mithila Review
Anfang des Jahres startete außerdem die englischsprachige Mithila Review in Zusammenarbeit mit dem National Democratic Insitute (USA) eine Hopepunk-Ausschreibung mit dem Thema „Planet Democracy: Stories of Hope, Courage, Unity & Compassion“, auf deren Ergebnis ich aus mehreren Gründen sehr gespannt war: Erstens, weil mich interessiert, wie Autor*innen das Thema 2022 und inmitten einer heftigen weltweiten Krise aufgreifen. Zweitens, weil mich interessiert, wie Autor*innen es inter- und transnational aufgreifen – immerhin ist die indischstämmige Mithila Review traditionell sehr global unterwegs. Und drittens hat mich die Demokratie im Titel angesprochen. Die scheint mir bei allen Utopie-Diskussionen oft zu kurz zu kommen. Klar, wir erleben derzeit ihre Krise live mit. Dennoch gibt doch gerade das zugleich Raum für ihre Verteidigung!
Jedenfalls, ich war gespannt und im August ist die Ausgabe nun erschienen und ich habe sie mir zu Gemüte gefüht:
Eingeführt wird die Ausgabe mit einem Editorial von Herausgeber Salik Shah, in der er Hopepunk kurz umreißt und sich dafür ausspricht, dass Hopepunk schon lange vor der Benennung durch Alexandra Rowland existiert habe: „Genre definitions come after the fact, not before. The story comes first, not genre.“ Eine Aussage, die ich vorsichtig unterschreibe, wenngleich die Benennung die Ränder stärkt und erst durch sie soziale Gebilde wie Movements sich effektiv herausbilden können.
Es folgen acht Kurzgeschichten und fünf Mal Lyrik. In der ersten Story, Robert Bagnalls „The Ones Who Scream America“, hört eine Frau bedeutsame Stimmen und weiß sie für sich zu nutzen. „Simplicity, Peace, Integrity, Community, Equality“ werden hier als die zentralen Werte herausgestellt. Als Einstieg empfand ich die Geschichte sperrig, allerdings hatte ich auch einige (sprachliche) Verständnisprobleme.
Besser gefallen hat mir Buzz Dixons „Trucker“. In einer dystopischen Zukunft werden Trucker nostalgisch als Helden der Vergangenheit verklärt. An einem Rastplatz treffen sich drei hochbetagte Ex-Trucker*innen, um über die alten Tage zu philosophieren. Zufällig stoßen sie dabei auf eine hochschwangere Geflüchtete und helfen ihr und ihrem just geborenen Kind mit einem Trick dazu, „nördlich des Sonnenvorhangs“ (=in Sicherheit) bleiben zu können. Die Elemente der Story sind clever miteinander verflochten, und sie weiß ihr übergeordnetes Thema – Nostalgie – ambivalent für sich zu nutzen. Selbst sprachlich gelingt es Dixon, die Mischung aus Sehnsucht und Ernüchterung zu transportieren. Einzig die zugleich naiv und unangenehm geschilderte Geburtsszene hätte es so nicht gebraucht.
Während „Trucker“ trotz des dytopischen Hintergrundes den hoffnungsvollen Unterton stets halten kann, kommt dieser in Eve Mortons „Milkman“ erst ganz zum Ende hin raus. In einem einerseits solarpunkesken, andererseits extrem dystopischen Setting geht es um zwei Frauen, die eine Möglichkeit finden, verträgliche Ersatznahrung für Säuglinge herzustellen. Eine ungewöhnliche Idee, stellenweise aber ebenfalls so unangenehm geschildert, dass ich sie ab der Hälfte nur noch quer gelesen habe.
Mark Rivetts „This Is My Home“ lässt sich im weiten Sinne als optimistischer Cyberpunk lesen: Kinder entwickeln hier eine Schwarmintelligenz und zwingen ihre Eltern erst zu veganem Essen, später sogar zum Weltfrieden. Für meinen Geschmack etwas zu naiv, aber mit interessantem Aufbau.
Geschichte Nr. 6, „In The Rhythms of the World“, stammt von Johnny Caputo und präsentiert uns eine Art … Moos? Pilz-Intelligenz? Jedenfalls irgendeine Art von Organismus, die sich selbst opfert, um ein Gift zu bekämpfen und Teil des „Rhythmus der Welt“ zu werden. Die poetisch erzählte Story verstömt starke Eco- und Lunarpunk-Vibes und fällt thematisch etwas raus, war aber (vielleicht gerade deshalb) mein Favorit der Ausgabe.
Mit Paulo de Costas „Harefoot Express“ gibt es dann noch einen relativ kurzen Slice-of-Life-Einblick in den Urlaub der Zukunft, ehe Jetse de Vries‘ „Zen and the Art of Gaia Maintenance“ den Story-Teil mit kosmpolitanischem Solarpunk abschließt. Interessant bei diesen beiden Geschichten fand ich, dass „Harefoot Express“ zu großen Teilen von Dialog lebt, „Zen …“ hingegen reines Tell ist. Ob es Absicht war, weiß ich nicht, aber sie wirken ein wenig wie Gegenstücke zueinander, auch weil hier der lokale, dort der globale Blick betont wird.
Die Lyrik von Mari Ness, J. D. Harlock, Angela Acosta, Florence Lenaers und Gretchen Rockwell bespreche ich nicht im Einzelnen, empfehle aber einen Blick auf die naturgemäß kurzen Texte zu werfen. Sehr kreativ fällt auf jeden Fall Florence Lenaers’ Ausblick auf das Schul-Curriculum der Zukunft aus, und mit Gretchen Rockwells „In My Utopias“ endet die Ausgabe angemessen hoffnungsvoll.
So viel also zu den einzelnen Beiträgen. Aber was ist mit der Ausgabe insgesamt?
Zunächst war ich ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert. Die Sache mit der Demokratie habe ich wohl zu wörtlich genommen – wenn man es interpretiert im Sinne eines aktiven, handelnden Volks, findet sich das in einigen der Texte wieder. Das passt dann auch zu „When Hope Meets Action“, dem Thema, unter dem das Editorial steht. Aber im engeren Sinne hat höchstens Lenaers‘ Gedicht einen direkten Bezug zur Demokratie als Staatsform. Allzu international ist die Autorenschaft ebenfalls nicht aufgestellt, der Großteil der Beteiligten ist aus Kanada, GB oder den USA. Was natürlich nichts über die Qualität aussagt und auch nur bedingt etwas über die Perspektive der Schreibenden. Dennoch hatte ich mir nach der internationalen Ausschreibung mit 200 Einsendungen hier etwas mehr Abwechslung erhofft.
Und wie steht’s um den Hopepunk? Ob es sich hierbei um einen umfassenden Abriss handelt, wie das Subgenre und/oder Movement heute international gesehen wird, finde ich angesichts des Mangels an gezielter Vergleichsliteratur schwierig zu beurteilen. Zumindest hat der Großteil der Storys den berühmten Kampf um den Rest im Wasserglas zu bieten, d. h. die Weigerung, angesichts (scheinbar) hoffnungsloser Ausgangslagen aufzugeben. Die wholesome Variante des Hopepunk findet sich aber nur vereinzelt. Viele der Geschichten entsprechen eher dem Muster aus dystopischem Setting mit einem kurzen, hoffnungsvollen Moment zum Ende hin. Einige der Storys würde ich dem Solarpunk zurechnen, insbesondere „Harefoot Express“ und „Zen And The Art Of Gaia Maintenance“. Allerdings sind die Grenzen hier ja ohnehin fließend, daraus macht die Ausgabe auch kein Geheimnis. Alle der Geschichten lassen sich zudem in der Science Fiction verorten, viele von ihnen greifen KI und erneuerbare Energien inhaltlich auf. Nach den ersten Geschichten war ich auch hier etwas enttäuscht über die mangelnde Abwechslung, aber nach hinten hin boten sich doch noch einige Überraschungen.
Letztlich ist die Ausgabe zwar nicht ganz, was ich mir rein vom Thema her erhofft hatte. Lesenswerte Geschichten, bedenkenswerte Ideen und Perspektiven auf Hopepunk bietet sie aber in jedem Falle und in einem können wir uns sicher sein: Eine Eintagsfliege war er nicht, der hoffnungsvolle Punk.
[Lesen kann man alle Texte der Mithila Review Nr. 16 online. Oder man kauft sich die Ausgabe als E-Book oder Print über Gumroad oder Amazon.]
*Dass gerade jetzt, wo Hopepunk wieder etwas mehr in den Fokus gerät, die Fortsetzung „Laylayland“ erscheint, ist meines Wissens Zufall. Aber ein bemerkenswerter.
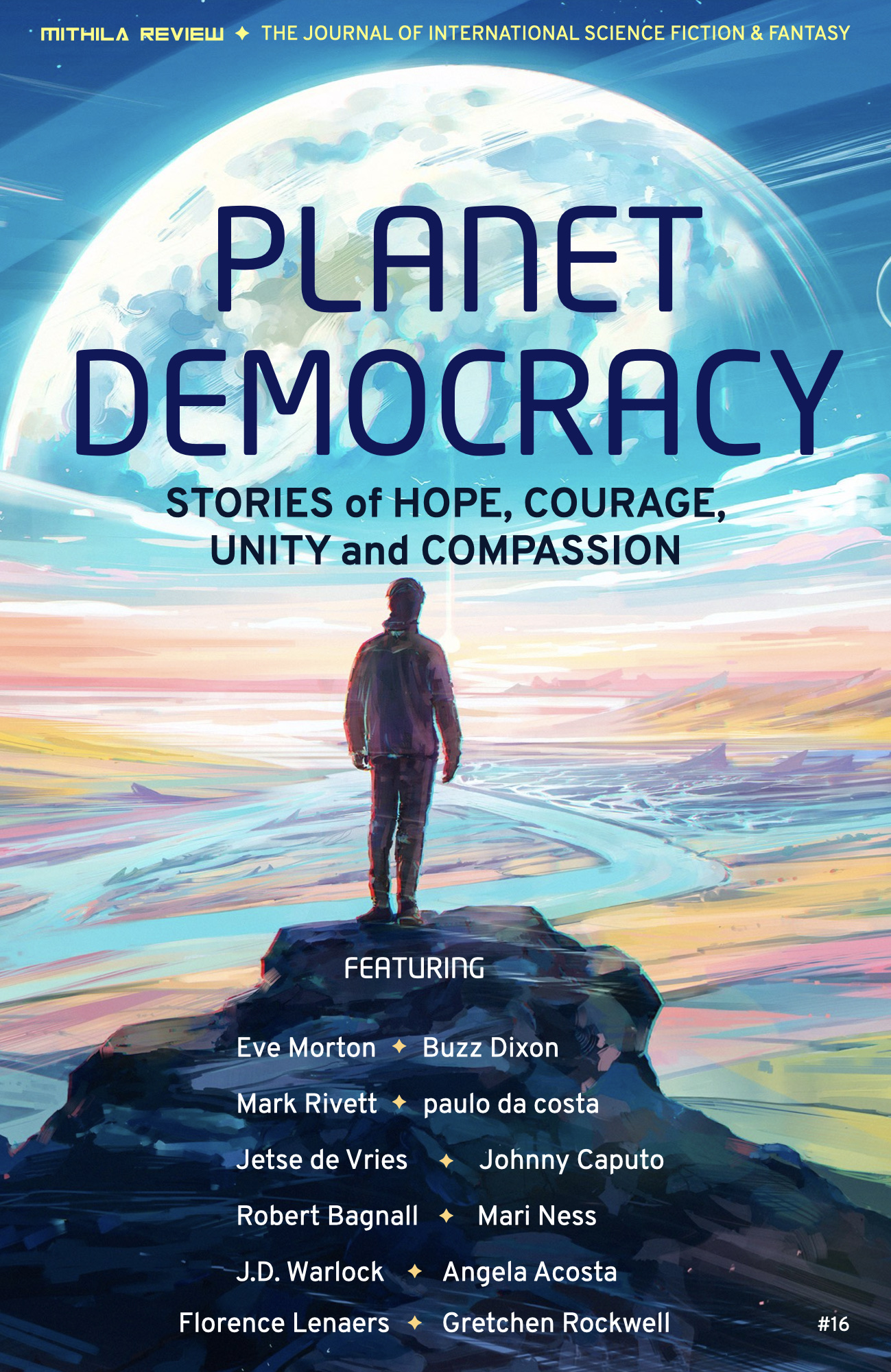
9 Gedanken zu „Hopepunk 2022 / Planet Democracy“