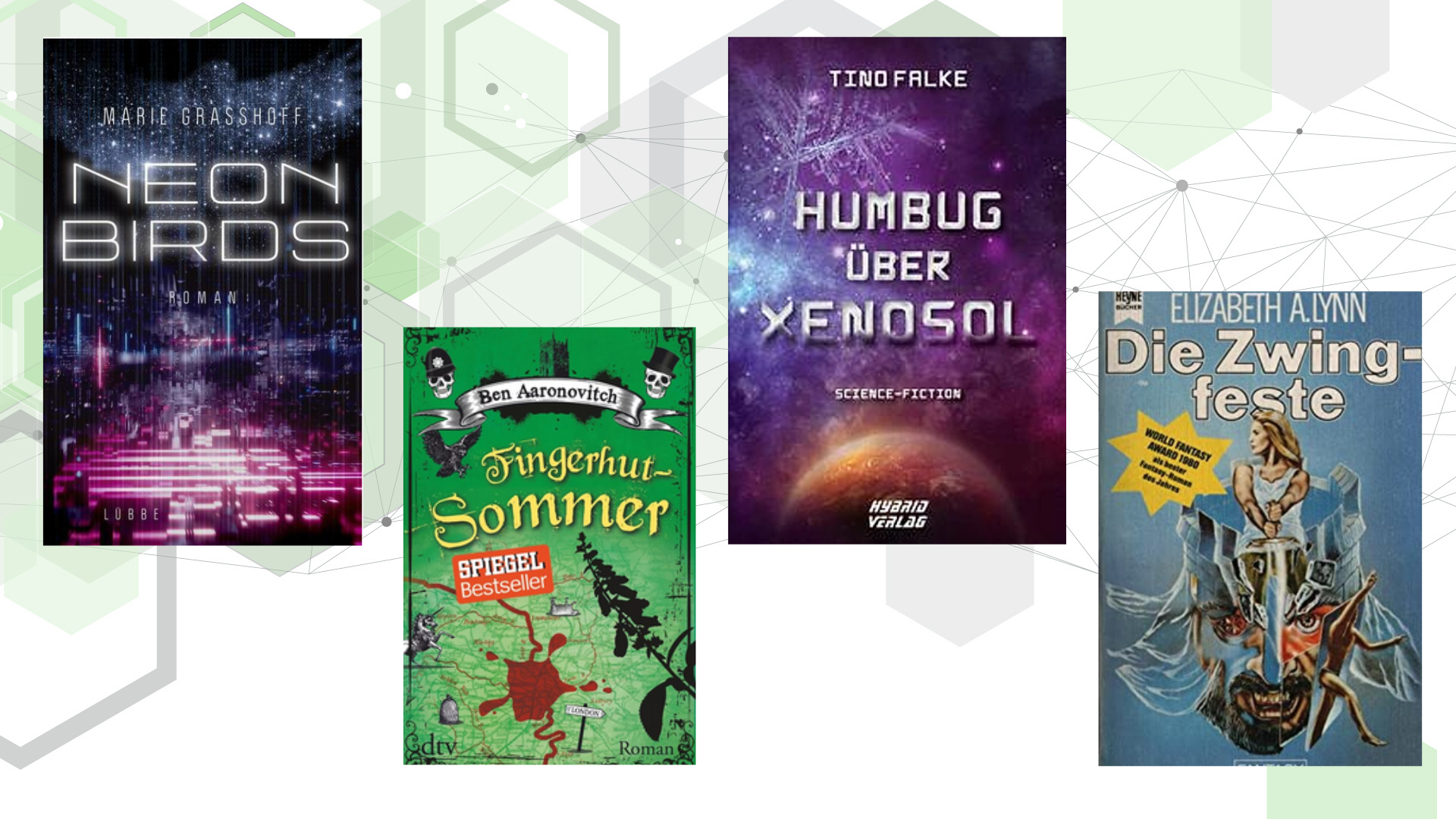
7+7 Buchansichten 2022, Pt. 1
2022 feiert sein Bergfest* und das heißt: Es ist Zeit für meinen Rückblick auf sieben in der ersten Jahreshälfte gelesene (und gehörte) Romane.
Es war lesetechnisch ein gutes Halbjahr, bis auf „Willow“ würde ich alle konsumierten Romane im 4- und 5-Sterne-Bereich anordnen, wenn ich so ein System nutzen würde. Trotzdem brauche ich weiterhin lange zum Lesen und vor allem zum Hören; ich bin schon fasziniert davon, in manchem Monat zwei Titel „geschafft“ zu haben. Hier nun die Kurzbesprechungen in willkürlicher Reihenfolge. Nicht enthalten sind „Die Berechnung der Sterne„, da ich darauf bereits ausführlich eingegangen bin, und mehrere Rereads (darunter „Der Träumer in der Zitadelle„).
(1) Vermaledeite Provinzfeen: „Fingerhut-Sommer“ von Ben Aaronovitch
Nachdem es Nachwuchs-Magier und Polizist Peter Grant schon mit Geistern, abtrünnigen Magier*innen und Flussgöttinnen zu tun hatte, sind nun, im fünften regulären Band der „Flüsse von London“-Reihe, mordlustige Einhörner und eine herrische Feenkönigin an der Reihe. Denn die entwickeln ein plötzliches Interesse an den Kindern eines Dorfes, und so muss sich Peter der Sache annehmen – wobei ihm die Provinz fast mehr zu schaffen macht als das Feenvolk.
Lange habe ich ein Buch nicht mehr so inhaliert wie dieses. Ich mag die Reihe um Peter Grant generell sehr gerne, aber dieser Band ist noch mal eine Spur flotter geschrieben als seine Vorgänger. Zum einen dürfte das am Wechsel des Settings liegen, zum anderen auch daran, dass die meiner Meinung nach etwas dröge übergeordnete Handlung rund um den gesichtslosen Magier hier kaum Erwähnung findet. Letzteres ist aber zugleich eine Schwäche des Bandes. So unterhaltsam Peters Ausflug in die Provinz auch ist, er bringt die Handlung und die zahlreichen in den Vorgängerbänden aufgeworfenen Fragen nicht weiter. Stattdessen werden umso mehr neue Fragen aufgeworfen und das abrupte Ende lässt etwas ratlos zurück. Ich bin sehr gespannt, ob es Aaronovitch gelingt, all die Fäden zusammenzuführen. Einfach wird das nicht.
„Die Flüsse von London: Fingerhut-Sommer“ von Ben Aaronovitch, dtv 2015, ISBN: 978-3-423-21602-9
(2) Charles Dickens in Space: „Humbug über Xenosol“ von Tino Falke
An dem Abend, da Kommandant Ebaneez Scrooge eine folgenschwere ethische Entscheidung treffen muss, erhält er Besuch von einer Zeitreisenden, die ihn auf einen wilden Trip durch Zeit und Raum mitnimmt. Wer Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ kennt, wird vielleicht ahnen, worauf das Ganze hinausläuft. Ich higegen ahnte nichts, da ich die Vorlage nicht kenne; aus demselben Grund war mir nicht klar, dass „Humbug“ offenbar ein Ausruf aus dem Original ist und ich habe eine satirische Space Opera im Stil von Douglas Adams erwartet. Das ist dieser Kurzroman definitiv nicht, im Gegenteil wird es stellensweise, wenn sich Scrooge seinen eigenen Kriegstraumata stellen muss, ziemlich düster. Nachdem die erste Irritation darüber verflogen war, hatte ich aber meine Freude an diesem Space-Abenteuer, das zwar trotz der Kürze ein paar Längen hat, aber durch den fantasievollen, dichten und aus sich selbst heraus erklärten Weltenbau punkten kann.
„Humbug über Xenosol“ von Tino Falke, Hybrid Verlag 2021, ISBN: 978-3-96741-144-7
(3) Military Solarpunk: „Neon Birds“ von Marie Graßhoff
Kommen wir zum Highlight meines bisherigen Lesejahres: „Neon Birds“ war 2019 meines Wissens der erste deutschsprachige Roman, der als Solarpunk beworben wurde. Neugierig hat er mich aber nicht so sehr deshalb gemacht, sondern mehr, weil ich es faszinierend finde, wie es ihm gelingt, verschiedenste Szeneecken und -generationen zu vereinen. Das Buch ist astreine Science Fiction und wird von Fans derselben durchaus geschätzt. Graßhoff gehört aber zu jenen Autor*innen, die ihre Fangemeinde zu großen Teilen über Insta beziehen, und auch hier hat „Neon Birds“ einen ordentlichen Hype erfahren, obwohl Bookstagram sonst nicht gerade für seine SF-Liebe bekannt ist. Graßhoff ist sogar regelmäßig Thema in der We are bookish, die sonst auf Romantasy und New Adult fokussiert ist. Und so viel sei schon mal verraten, „Neon Birds“ ist von beidem ziemlich weit entfernt.
Erzählt wird aus verschiedenen Perspektiven vom Kampf gegen KAMI, einen technischen Virus, der Menschen in willenlose Zombies verwandelt und zunehmend intelligenter und schwarmgetriebener agiert. Dabei verhält sich „Neon Birds“ zu Solarpunk ähnlich wie „When The Music’s Over“ zum Cyberpunk: Das Subgenre bildet hier mehr den ästhetischen Unterbau, es gibt aber nicht die Handlung vor, was ihr durchaus zu Gute kommt. Die Gesellschaft von „Neon Birds“ trägt die typisch kosmopolitisch-utopischen (prä-2018-)Züge des Solarpunk, aber hey, wer sagt, dass es deshalb keine technischen Viren oder irren Generäle geben sollte? Apropos: Viel mehr noch als Solarpunk ist „Neon Birds“ Military Science Fiction, was auf den ersten Blick eine schräge Kombi ist, aber sie funktioniert.** Mir hat das Buch jedenfalls außerordentlich gut gefallen, wenngleich das in erster Linie nicht dem Setting, sondern Handlung und Figuren zu verdanken ist. Ich lese oft Bücher, in denen mich die Handlung oder die Figuren überzeugen. Dass beides zusammenkommt, hab ich hingegen nicht so oft. In den Details gab es das eine oder andere, was mich irritiert hat, und ich weiß, ich bin ein Snob, aber die ständige falsche Verwendung von „scheinbar“ ging mir echt auf die Nerven. Aber das ändert nichts an meiner Gesamtbeurteilung.
Damit ist „Neon Birds“ übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass es manchmal lohnt, Autor*innen mehr als eine Lesechance zu geben; mit Graßhoffs Dystopie „Kernstaub“ wurde ich seinerzeit nicht wirklich warm (aber vielleicht gebe ich auch der noch mal eine Chance).
„Neon Birds 1: Neon Birds“ von Marie Graßhoff, Bastei Lübbe 2019, ISBN: 978-3-404-20000-9
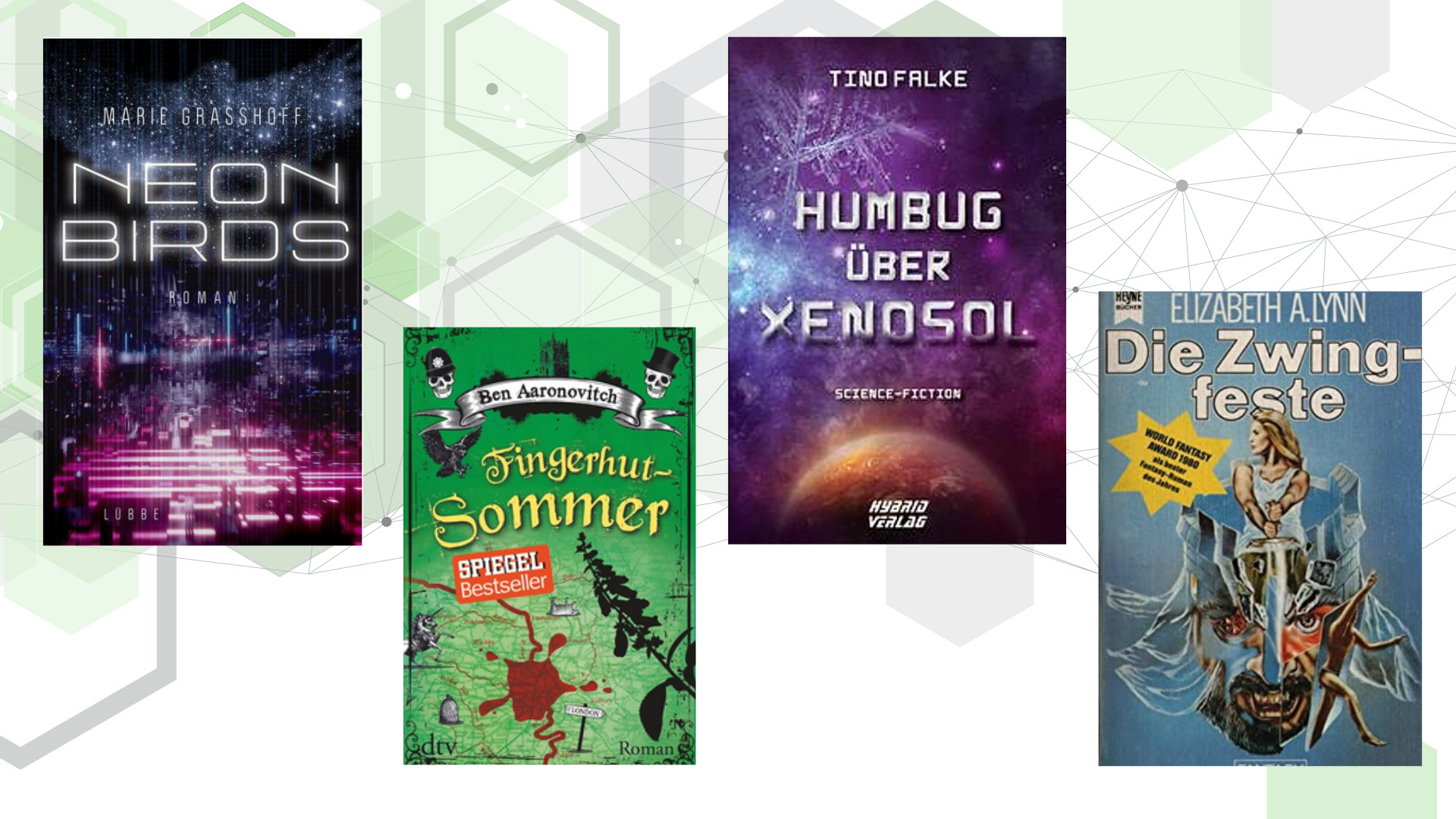
(4) Progressive Fantasy Anno 1979: „Die Zwingfeste“ von Elizabeth A. Lynn
Über Die Legenden von Tornor, deren ersten Band „Die Zwingfeste“ bildet, habe ich oft in der Sekundärliteratur gelesen. Meist wurde das Buch als Beispiel genommen, um zu zeigen, wie die Sword & Sorcery in den 1970ern versucht hat, ihren tropes zu entwachsen bzw. diese umzudeuten. Das Buch fängt noch relativ klassisch an: Der „Südländer“ Col überfällt die Feste Tornor und tötet den Fürsten Athor. Dessen Getreuer Ryke wird zunächst von Col in Dienste genommen, ehe ihm gemeinsam mit Athors Sohn Errel die Flucht gelingt. Dabei erhalten sie Hilfe von Sorren und Norres, zwei vermeintlichen ghyas, d. h. Menschen, die weder Mann noch Frau sind.*** Gemeinsam reisen sie gen Süden in das Dorf Vanima, wo ein einstiger Bandit seine Vision eines Ortes verwirklicht hat, an dem jeder gleich ist. Doch der Krieg im Norden bringt selbst die Bewohner Vanimas dazu, Partei zu ergreifen.
Ein paar Begriffe wirken etwas altertümlich, doch ansonsten merkt man „Die Zwingfeste“ das Alter kaum an. Der Schreibstil ist sehr angenehm, die Erzählung, obwohl sie fast gänzlich ohne Action auskommt, dicht. Und die Themen, die sich durch das Buch ziehen, sind heute ohnehin aktuell wie nie (oder wie … seit Jahrzehnten nicht mehr). Lynn macht keinen Hehl daraus, mit dem Buch eine gewisse Agenda zu verfolgen. „Unterschiede machen mich neugierig. Und das ist genau der Unterschied zwischen euch und mir“, so heißt es von Col an einer Stelle (S. 54). Und das Zusammenspiel solcher Unterschiede zieht sich durch das ganze Buch: Die Unterschiede zwischen Kulturen, zwischen Ethnien, zwischen Geschlechtern – und inwiefern diese zwar bestehen, doch letztlich an Bedeutung verlieren. Dass ausgerechnet Col, der Antagonist des Buchs, sich entsprechend äußert, ist einer von vielen Kunstgriffen, mit denen das Buch einen zwingt, die eigenen Erwartungen immer wieder zu hinterfragen. Spannend ist dabei auch, dass die Handlung aus Sicht Rykes erzählt ist, dem es sichtlich schwer fällt, seine Werte und Normen zu überdenken oder sich einzugestehen, dass sein Held Athor ein ziemlicher Tyrann war, ohne den Tornor womöglich besser dran ist.
Es gäbe noch viel mehr zum Buch zu erzählen, vor allem auch zur Rolle von Norres und Sorren oder zum zwiespältigen Bild des pazifistischen Ortes Vanima. Aber nun, die Besprechung soll an dieser Stelle nicht ausarten, und ich bin gespannt, was die beiden (in der Handlung offenbar weitgehend unabhängigen) Folgebände wiederum zu bieten haben.
„Die Legenden von Tornor 1: Die Zwingfeste“ von Elizabeth A. Lynn, Heyne 1983, ISBN: 3-453-30886-7 (Der Roman wurde 2000 als „Die Winterfestung“ von Knaur neu aufgelegt.)
(5) Nostalgiecore: „Willow“ von George Lucas
Von einem gut gealterten zu einem weniger gut gealterten Klassiker: Ein paar Worte zu dieser Jugendroman-Buchfassung des Films von 1988 habe ich bereits im Beitrag über novelizations verloren – u. a. habe ich dort erzählt, dass sich hinter dem PR-trächtigen Namen von George Lucas offenbar die Autorin Joan D. Vinge verbirgt. Die Hintergründe spare ich mir also an dieser Stelle. Widmen wir uns stattdessen dem Inhalt: Willow, Angehöriger des Volks der Nelwyns (Halblinge quasi), findet ein ausgesetztes Daikini(=Menschen)-Baby. Das Mädchen entpuppt sich als prophezeite zukünftige Königin, die die Herrschaft der grausamen Bavmorda beenden soll. Natürlich will Bavmorda der Kleinen an den Kragen, und so ist es an Willow und einer Handvoll Verbündeter, das Mädchen zu retten und der Prophezeiung zu ihrer Erfüllung zu verhelfen.
Joa. Auch wenn die Handlung vor allem dank des eher untypischen Protagonisten ein paar Überraschungen bereithält, erfüllt sie doch sämtliche Klischees, die man von 80er-Jahre-Fantasy erwartet. Wir haben einen schwertschwingenden Schwerenöter, einen schwertschwingenden Bösewicht, eine böse Zauberin, eine gute Zauberin, ein Love Interest für den Schwertguy, einen Fluch, eine Prophezeiung und na ja, wir wissen doch alle schon, wie das Buch endet, oder? Ich weiß nicht, ob der Film konsequenter erzählt ist, aber das Buch schert sich nicht im Mindesten um Erklärungen oder Konsistenz. Dinge passieren, Figuren tauchen auf und verschwinden wieder, die böse Königin ist böse, weil sie böse ist, und das alles ist eben so, weil es so ist. Kann man nur in einem heftigen Anfall von Nostalgie lesen, und auch dann gibt es sicher bessere Alternativen. „Die Zwingfeste“ zum Beispiel.
„Willow“ von George Lucas / Joan D. Vinge, Loewe 1988, ISBN: 978-3-78552227-1
(6) Mit Whiskey gegen Verschwörungen: „Lemmy Lokowitsch – Das Syrikon-Projekt“ von Laura Dümpelfeld
Bei diesem Buch tue ich gar nicht so, als könnte ich es auch nur halbwegs objektiv bewerten. Laura ist eine meiner engsten Freundinnen und die Geschichten über ihren Lemmy begleiten sie, so lange ich sie kenne (also seit ziemlich genau zehn Jahren). Schön, dass es der sarkastische Noir-Journalist, der auf der Suche nach einer verkaufsstarken Story in einen Fall über illegale Experimente an einem indigenen Elfen-Volk verwickelt wird, nun endlich zwischen zwei Buchdeckel geschafft hat. Die recht knappe Geschichte ist flott und trotz des stellenweise ernsten Themas humorvoll erzählt. Die phantastische, aber ohne viel Magie auskommende Alternativwelt wird mit Liebe zum Detail und erfrischender Selbstverständlichkeit erzählt – in dieser Hinsicht habe ich mich etwas an „Humbug über Xenosol“ erinnert gefühlt. Etwas zu viel des Guten war mir hingegen Lemmys allgegenwärtiger Whiskey-Konsum, der einige Situationen bei aller Leichtigkeit schon bissl unangenehm gemacht hat.
„Lemmy Lokowitsch – Das Syrikon-Projekt“ von Laura Dümpelfeld, Edition Roter Drache 2021, ISBN: 978-3-96815-030-7
(7) Lächeln beim Kochen: „Das Känguru-Manifest“ von Marc-Uwe Kling
Das Autoren-Ich aus „Die Känguru-Chroniken“ wohnt weiter mit seinem Känguru-Mitbewohner zusammen. Der gründet das Asoziale Netzwerk und beide kämpfen gegen das Ministerium für Produktivität. Das ist vielleicht nicht ganz so unterhaltsam wie im ersten Band, aber der war halt auch auf einem krassen Niveau. Hatte wieder viel Spaß, die Satire kam an, Kochen ist meistens geglückt (ich höre die Känguru-Hörbücher traditionell beim Kochen).
Beste Besprechung ever, was?
„Die Känguru-Chroniken 2: Das Känguru-Manifest“ von Marc Uwe Kling, Ullstein 2011, ISBN 978-3-548-37383-6
*Ich finde den Begriff „Bergfest“ sehr seltsam. Wie geht man damit um? Wird ein Bergfest wirklich gefeiert? Ist es überhaupt „ein“ Bergfest? Und verwendet man ihn nur, wenn man etwas schnell herumbekommen will (dann wäre er hier fehl am Platze, Carpe Diem und so!)?
**Hätte eigentlich Bock, in einem eigenen Beitrag auszuformulieren, wie sich in „Neon Birds“ Military SF, Solarpunk und Cyberpunk miteinander verbinden. Aber vermutlich wird zeitlich nichts draus, zumal ich mir kaum Notizen gemacht habe und es bei Hörbüchern so schwierig ist, Sachen „nachzuschlagen“. Ach ja, habe „Neon Birds“ als Hörbuch gehört, was ich rückblickend etwas schade finde. Es wäre glaube ich ein Roman mit Reread-Potenzial und ich würde einige Stellen gerne noch mal nachlesen, aber eine „Nach-Hörerin“ bin ich bisher nicht.
***[SPOILER zu „Die Zwingfeste“]
„Vermeintliche ghyas„, weil sich letztlich herausstellt, dass die beiden ein lesbisches Frauenpaar sind. Aus heutiger Sicht vielleicht schwierig, aber innerhalb des Buchs wiederum ein interessanter Weltenbau-Kniff, da in Tornor ghyas akzeptiert werden, gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern oder Frauen jedoch nicht.
8 Gedanken zu „7+7 Buchansichten 2022, Pt. 1“
Ist jetzt schon wieder paar Monate her, dass ich Willow & paar andere ältere Fantasys-Filme geschaut hab. Der hat mich nicht überzeugt, das Erzähltempo schwankt sehr heftig & er ist schon zu Mainstream, um die ein oder andere abseitige Idee zu überzeugen, aber halt technisch noch total Kostümfilm… Zumindest hat mir der (&paar andere) gezeigt, was für eine Offenbarung dann die Herr der Ringe-Verfilmungen gewesen sein müssen.
Ich hab den Eindruck, dass viele dieser 80er-Filme schwer anguckbar sind, wenn man nicht mit ihnen aufgewachsen ist. Ich kann selbst den Hype um „Die Braut des Prinzen“ nur bedingt nachvollziehen, obwohl ich das Buch sehr gerne mag. Dagegen empfinde ich für „Legende“ eine gewisse nostalgische Zuneigung, weil ich ihn als Kind oft in der Weihnachtszeit geguckt habe. Aber ich kann gut verstehen, warum ihn Leute, die ihn heute das erste Mal gucken, weniger toll finden.
Legende hat zumindest diese Weirdnes für sich, man merkt, dass irgendwas besonderes erreicht werden sollte und irgendwie überhaupt nicht klappt und will wissen, was passiert ist. An Willow hat mich genervt, dass es so totaler Mainstream ist, aber ohne wenigstens die Qualität der Bilder und das saubere Erzähltempo, mit dem man so nen 08/15 Plot erträgt.