
Dystopische Utopien und utopische Dystopien
Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse habe ich auch 2021 an einem der PAN-Diskussionspanels teilgenommen. Dieses Mal ging es dabei (u. a.) um Dystopien in der aufstrebenden Ära der Utopien, neben mir haben Thilo Corzilius, Melanie Vogltanz und Maike Braun mitdiskutiert. Bei einem Punkt waren wir uns dabei einig: In den meisten Fällen ist es eine Frage von Zeitpunkt, Perspektive und Leerstellen, ob ein Werk eher als Utopie oder eher als Dystopie eingestuft wird. Beispiel „Elysium“ (Vorsicht, SPOILER): Zu Anfang bewegt sich der Cyberpunk-Streifen für die Erdenbürger klar im Bereich der Dystopie, denn nur wer es auf die Gated Community Elysium schafft, führt ein angenehmes Leben. Am Ende wandelt sich die Handlung scheinbar zur Utopie, da Elysium für alle zugänglich wird. Allerdings kann man sich denken, dass dieser Zustand nicht lange anhalten wird, da die Ressourcen nun mal nicht auf so viele Leute ausgelegt sind. Gut, eventuell wird das Wissen von dort geteilt, es entstehen neue Raumstationen, Versorgungsschiffe usw. Aber wahrscheinlicher ist wohl, dass es früher oder später doch wieder die Stärkeren oder Mächtigeren sein werden, die den Zugang zu Elysium und dessen Errungenschaften kontrollieren.
Gerade in der deutschsprachigen Science-Fiction-Tradition nahm man es mit der Trennung in Utopie und Dystopie nicht immer so genau – eine Zeitlang wurde gefühlt alles, was irgendwie eine Zukunftsgesellschaft imaginiert, als „utopisch“ bezeichnet. Was rein vom Wortsinn her einleuchtet, aber zum heutigen Diskurs nur noch bedingt passt. Auch wenn es Dystopien in unserem heutigen Verständnis seit mindestens hundert Jahren gibt und den Begriff sogar noch länger[1], ist die popkulturelle Auseinandersetzung sehr von den jüngeren Dystopie-Bildern der entsprechenden Jugendbuchwelle (ab 2008), aber auch durch den über die Genreliteratur hinausgehenden Grimdark-Boom beeinflusst.
Hohe Maßstäbe für Utopien
Dieser Boom gilt nun mehr oder weniger als überkommen und die Lesewelt giert nach Utopien. Unfairerweise ist es dabei deutlich leichter, eine „reine“ Dystopie anstatt einer „reinen“ Utopie zu schreiben, auch wenn letztlich beidem das Punktuelle anhaftet. Selbst cozy Hopepunk-Romane wie Becky Chambers „Der lange Weg zu einem fremden Planeten“ deuten an, dass im Universum längst nicht alles shiny ist. Würden sie das nicht tun, würde ihnen wiederum vorgeworfen werden, unrealistisch zu sein.
Hinzu kommt, dass „utopisch“ gelabelten Movements wie Hope- oder Solarpunk nachgesagt wird, mehr schöner Schein als künstlerisches Sein zu sein, da es ihnen an Konfliktmaterial fehle. Schaut man in entsprechend vermarktete Werke, wird allerdings schnell deutlich, dass das nicht stimmt – ein Hopepunk-Roman wie „Wasteland“ hat ebenso Konflikte zu bieten wie die Kurzgeschichten aus Gerson Lodi-Ribeiros „Solarpunk“-Anthologie. Bloß sind wir dann wieder bei oben benanntem Problem, dass solchen Geschichten oft auch etwas Dystopisches anhaftet. Ironischerweise gilt das gerade für den Solarpunk, dem man den großen (und wiederum längst nicht immer rein dystopischen) Cyberpunk-Bruder oft noch sehr anmerkt. Selbiges gilt übrigens für große solarpunkige Real-Visionen wie Telosa oder Neom.
In Anderwelt-Romanen, die ohne die Dominanz dieser streitbaren Spezies namens Homo sapiens auskommen, scheint es leichter zu sein, utopische Bilder zu entwerfen. Aktuell lese ich beispielsweise James Sullivans „Das Erbe der Elfenmagierin“, dessen dargestellte Gesellschaften schon deutlich inklusiver und diverser und dadurch utopischer wirken als unsere. Mit „Die Sommerlande“ hatte ich 2019 selbst eine scheinbar utopische Welt entworfen, die nur durch eine Fehlfunktion plötzlich nicht mehr so happy und glanzvoll war wie eh und je. Aber nun, schaut man bei solchen Gesellschaften genauer hin, findet man auch hier die Haare in der Suppe – die Außenseiter und Ausgestoßenen, die Habgierigen und die Hierarchien. Alles andere wäre doch unrealistisch.
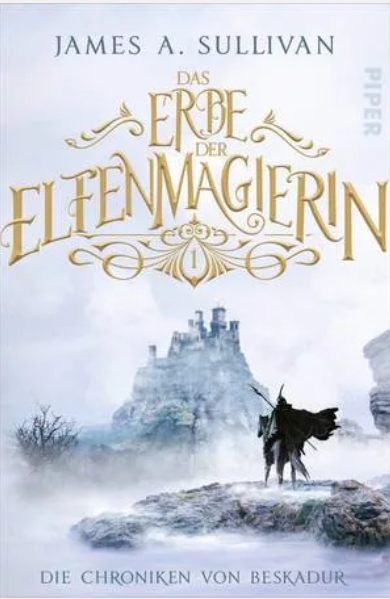
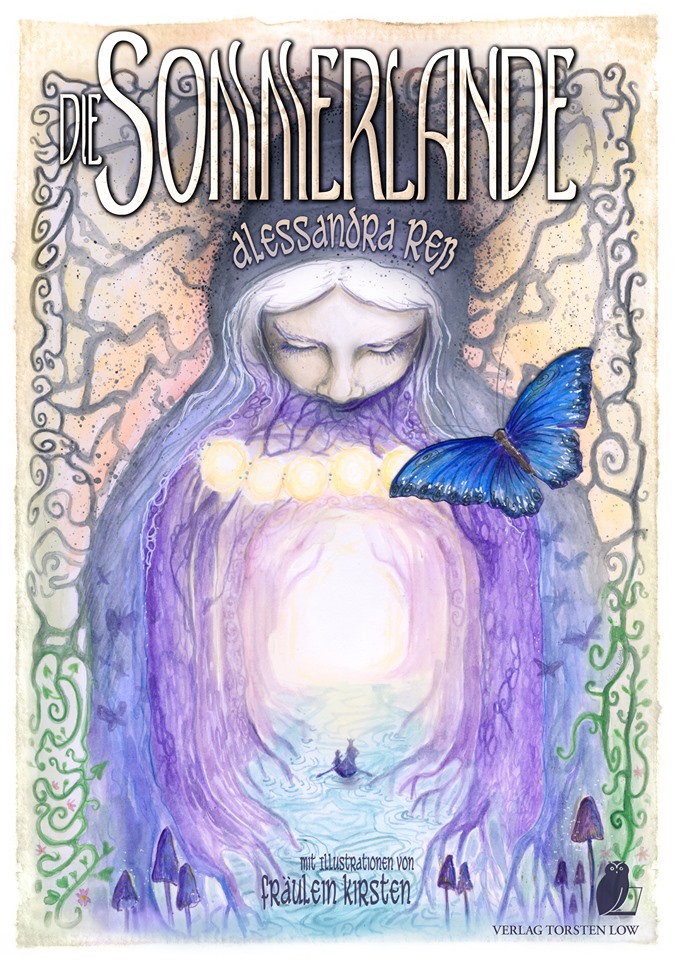
Letztlich gehen wir mit Utopien unrealistisch hart ins Gericht. Wir erwarten Perfektion, obwohl doch eigentlich längst klar ist, dass eher Progression das Ziel ist. In meinem Blogbeitrag zu Roberta Spindlers „Sun in the Heart“ sprach ich von einem „pragmatischen Utopia“; das Ideal, oder sagen wir, das Ziel eines kosmopolitisch-pragmatischen „not perfect but better“ war es, was mich ursprünglich am Solarpunk-Movement fasziniert hatte. In letzter Zeit scheint es mir oft, als bewege es sich davon weg, stattdessen hin zu einem „Alles auf einmal“ mit strengeren universalistischen Normen. Andererseits, erst im November formulierte Justine Norton-Kertsons im Solarpunk Magazine eine wiederum idealistisch-pragmatischere Anschauung.
Utopisches in meinen eigenen Romanen
Okay, jedenfalls – wenn wir Utopien derart „Luft nach oben“ und dystopische Elemente zugestehen, können wir dann nicht auch die meistens vorhandenen utopischen Elemente in den Dystopien prominenter betrachten?
Drei meiner veröffentlichten Romane werden mehr oder weniger als Dystopien bezeichnet. Nachvollziehen kann ich das bei allen, je nach Roman habe ich es auch selbst forciert. Dennoch habe ich den Gesellschaften der drei Settings immer auch bewusst utopische Elemente verpasst – und sie dann selbst durch die Figuren kritisiert, weil ich irgendwo Philanthropin bin, der Menschheit aber trotzdem nicht zutraue, das Denken in Wir und Ihr je ablegen zu können (außer es tauchen Aliens o. Ä. auf, aber dann haben wir halt ein neues Ihr, nech). Also. Schauen wir mal genauer auf die Gesellschaften in den drei Romanen und ob sie nun utopisch oder dystopisch sind:
Spielende Götter
Hier haben wir eine Gesellschaft, die ihre Konflikte nicht mehr im Real Life (hier als Primärrealität bezeichnet), sondern virtuell austrägt. Das ist …
- utopisch, weil im RL weniger Leute zu Schaden kommen.
- dystopisch, weil es zulasten der Virtuellen geht, also der Figuren, die quasi dafür kreiert wurden, dass man die Wut an ihnen auslässt.
Hinzu kommt, dass die primärreale Gesellschaft in drei Schichten unterteilt und es kaum möglich ist, von einer in die andere zu wechseln. Gleichheit gibt es also keine, aber zumindest ist für jeden gesorgt. Oder doch nicht? Ich hab darauf zwar Antworten, aber der Roman selbst lässt zugegebenermaßen Leerstellen bei der Frage, was z. B. mit Ludens, d. h. Mitgliedern der untersten Schicht, ist, wenn diese nicht arbeiten können oder wollen.
Liminale Personae
Hier haben wir Pandora, eine kleine Enklave, die sich von der feindlichen, zombieverseuchten Außenwelt abgeschottet hat. Innen ist für alle gesorgt, aber jede Person muss dafür der ihr zugewiesenen Betätigung nachkommen – quasi Modell-Kommunismus auf Kleinstadtebene. Das ist …
- aus Sicht der Protagonistin Nihile und ihrer Mitstreitenden „dystopisch“, weil sie ihre Zukunft nicht selbst in die Hand nehmen dürfen.
- utopisch, weil an alle gedacht wird und alle einander gleichgestellt sind. Mit Ausnahme eines kleinen, anonymen Kreises von Lenkenden, welche die Bewohner Pandoras deren Tätigkeiten zuweisen und die Geschicke der Stadt lenken.
[SPOILER INCOMING] Nun, Nihile wird feststellen, dass die Frage der Utopie eine relative ist (duh!) und Pandora im Vergleich zur sektenartigen Nachbarenklave oder zum Leben in der Wildnis noch die (für sie) beste Option.
Die Türme von Eden
Persönlich würde ich „Die Türme von Eden“ nicht als primär dystopische Erzählung bezeichnen, aber in Rezensionen taucht das häufiger mal auf. Ich vermute, das liegt vor allem an der Gemeinschaft der Liminalen oder an der generell kalten Atmosphäre des Romans. (Ich beziehe den Dystopie-Begriff primär auf etwas Soziales, aber nun, Atmo und Community bedingen einander.) Die Gesellschaften des Sternensystems Aditi sind insgesamt vielfältig genug, dass sich theoretisch jede Person da niederlassen kann, wo’s ihr am besten gefällt. In der Praxis ist das aber natürlich nicht so, da man sozial, emotional und ökonomisch in der Regel in einem gewissen Umfeld festhängt. Die Hauptfiguren zeigen diese Ungleichheit ja schon [SPOILER, ONCE AGAIN]: Dante, der als Geflüchteter erst zusehen musste, dass er sich seine neue Heimat „verdient“, ehe er dort als Bürger aufgenommen wurde. Keri, die wegen eines Aberglaubens verstoßen wurde. Und dem gegenüber Misaki, die ihre Heimat als den besten Ort des Universums begreift, da sie hier äußerst privilegiert aufgewachsen ist und das Glück hat, sich gut in die Gemeinschaft einfügen zu können.
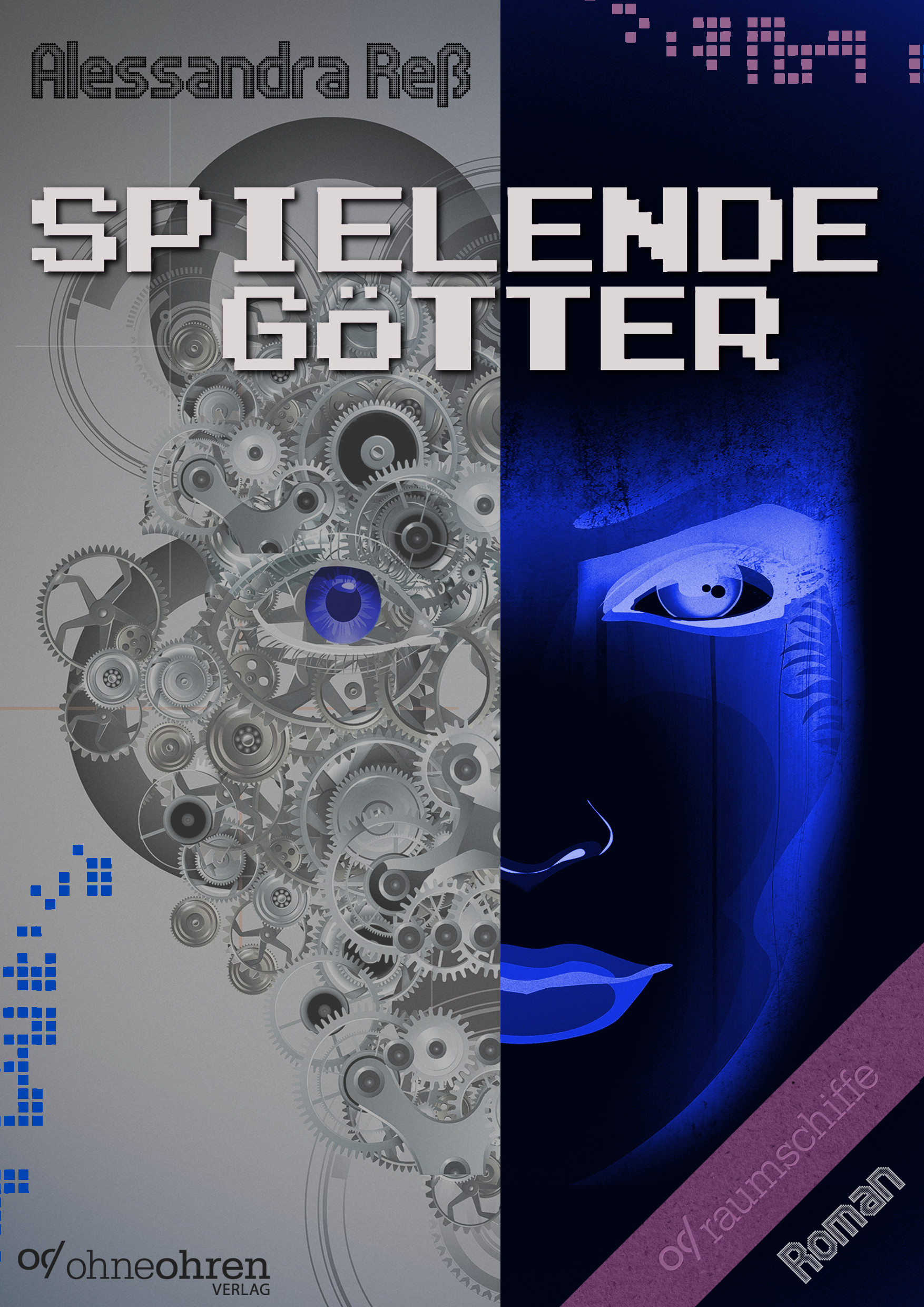
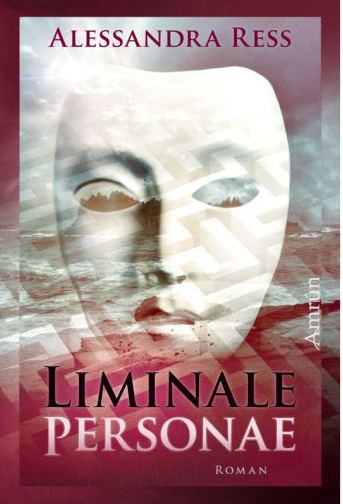
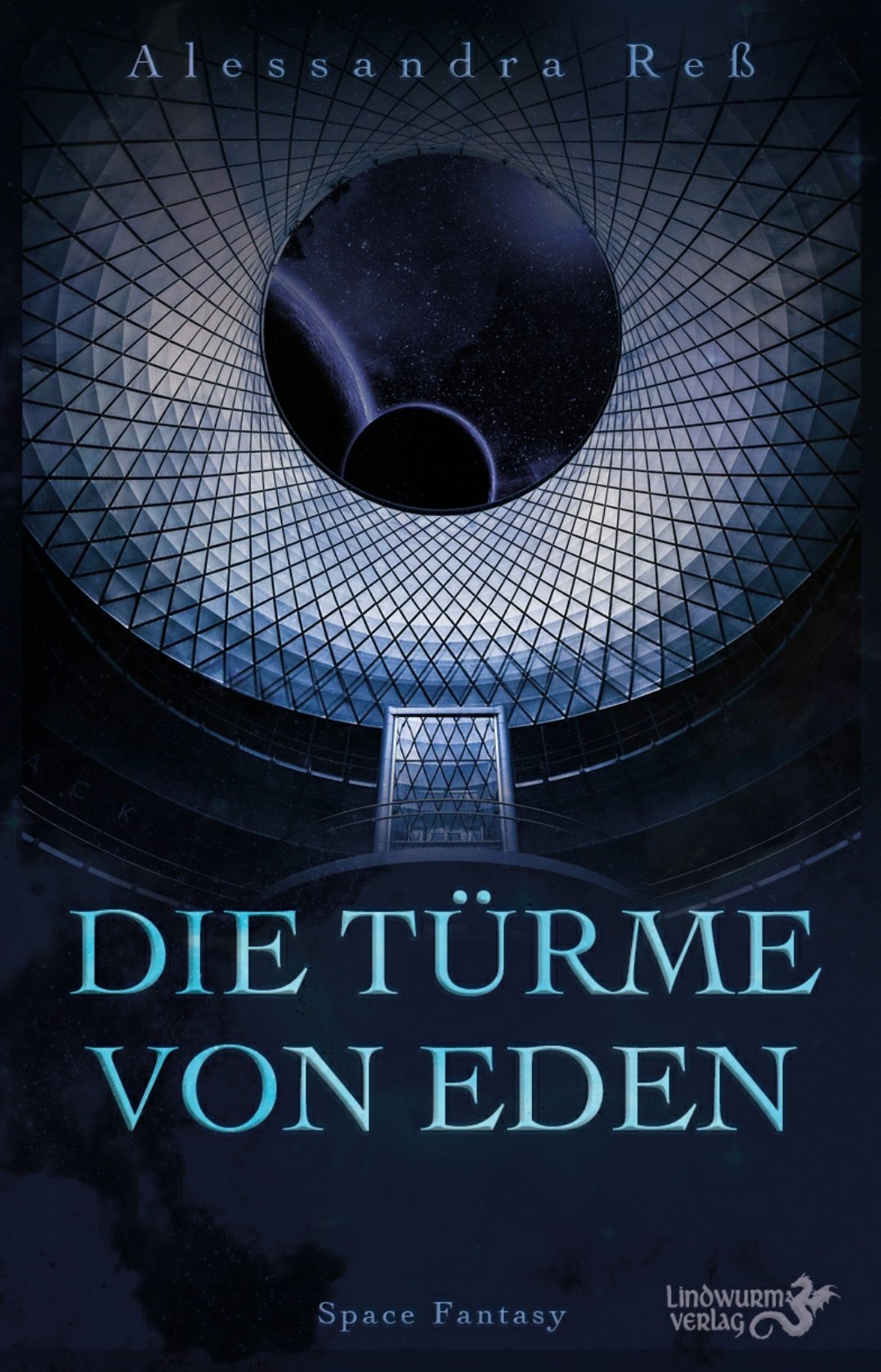
Tja. Utopie und Dystopie hängen also eng zusammen. Wie das eine oder andere gewichtet wird, hängt letztlich von der Lesart und damit implizit den Umständen, der Bildung, den Normen, der ganzen Sozialisation der Lesenden ab. Nun, und vom Marketing.
(Was ein Schlusswort.)
[1] Vermutlich wurde der Begriff „dystopia“ in den 1860er Jahren von John Stuart Hill eingeführt.

4 Gedanken zu „Dystopische Utopien und utopische Dystopien“