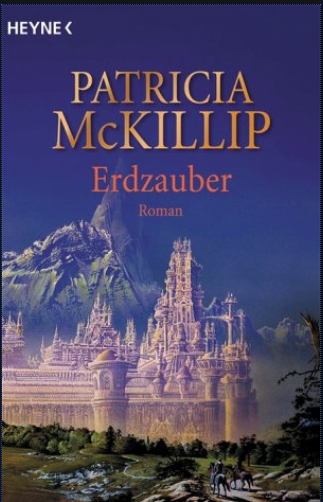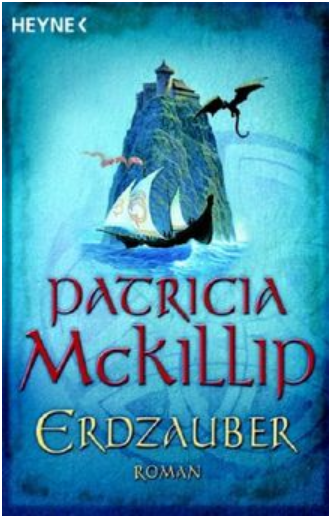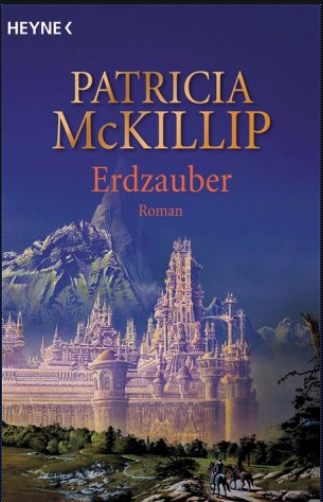
Klassiker-Reread: Patricia A. McKillips „Erdzauber“ (6/6)
Teil 6: Ein Gespräch u. a. über Handlungsstrukturen, das Böse und den Tod
Finale! Einen halben Monat haben Peter von Skalpell und Katzenklaue und ich unserem Erdzauber-Reread gewidmet, und mit Teil 2 unseres Gesprächs beschließen wir die Reihe nun. Hier noch einmal eine Übersicht über die bisherigen fünf Beiträge:
- Teil 1: Zur Entstehung der Erdzauber-Trilogie im Kontext ihrer Zeit
- Teil 2: Elemente der keltischen Mythologie in Erdzauber
- Teil 3: Peters Rückblick auf seine vorangegangenen Erdzauber-Lektüren
- Teil 4: Mein Erstkontakt mit Erdzauber
- Teil 5: Peter und ich sprechen über Worldbuilding, Nostalgie und Figurenkonstellationen in bzw. rund um Erdzauber
… und an Teil 1 des (per Mail geführten) Gesprächs schließt nun nahtlos der folgende Beitrag an, indem wir uns u. a. mit den Handlungsstrukturen, der Rolle der Gestaltwandler und einem Vergleich zu Joy Chants „Wenn Voiha erwacht“ widmen. Viel Spaß damit, und wir hoffen, dass euch die Reihe gefallen hat. Vielleicht hat sie ja sogar den*die eine*n oder andere*n dazu bewogen, sich die Trilogie (erneut) vorzunehmen …
***
Handlungsstrukturen und der Aufbau der Trilogie
PS: Den dritten Band fanden wir wohl beide am schwächsten. 😉 Und zumindest was meine eigene leichte Enttäuschung betrifft, habe ich sogar eine Art „Theorie“, die die Gründe dafür wenigstens teilweise erklärt.
Erdzauber beginnt als eine typische High-Fantasy-Geschichte: Ein Auserwählter, der aus dem Krähwinkel des Reiches stammt, begibt sich zusammen mit einer Mentorenfigur auf eine Queste, von deren Ausgang das Schicksal der Welt abhängen könnte, hadert dabei aber anfangs noch mit seiner Bestimmung. So weit, so klassisch. Doch am Ende des 1. Bandes kommt es zu einer überraschenden Wendung, die die Erzählung quasi aus der Bahn wirft.
Und dann tritt Rendel in den Vordergrund. Was eine der wirklich coolen Seiten der Trilogie ist. Denn jemand wie sie „gehört“ eigentlich nicht in so eine Geschichte. Wenn Thod am Ende zu ihr sagt: „Euch habe ich nicht erwartet“, dann hat das beinah Metacharakter. Sie hat keine Lust, das „Heiratsobjekt“ zu sein, um das sich die Vasallen ihres Vaters kabbeln, und begibt sich lieber selbst auf eine Queste. Deren bewusstes Ziel ist zwar die Suche nach Morgon (bzw. nach dem Grund seines scheinbaren Todes), doch wie jede echte Queste ist sie in Wirklichkeit vor allem ein Prozess der Selbstfindung. Rendel entdeckt das in ihr schlummernde Erbe Ylons, des Gestaltwandlers, und beginnt die Macht zu erforschen, die ihr damit gegeben ist. Das stürzt sie in mindestens ebenso tiefe Selbstzweifel wie Morgon seine Sternenträger-Bestimmung. Parallel dazu entwickelt sich die Freundschaft zwischen ihr und Lyra.
Aber als Ganzes betrachtet bleibt die Trilogie halt doch dem klassischen High-Fantasy-Modell verpflichtet. Am Ende muss deshalb der Große Kampf um das Schicksal der Welt stehen. Und das führt automatisch dazu, dass im dritten Band Morgon als der Auserwählte wieder ins Zentrum rückt. Rendels Entwicklung, die ich eigentlich spannender fand, wird etwas an den Rand gedrängt, findet teilweise sogar Off-Screen statt. Genau genommen erleben wir nie wirklich mit, wie sie es schließlich schafft, mit ihrem Erbe klarzukommen. Als sie bei Morgon in der Einöde auftaucht, hat sie es einfach gemeistert. Schuld an alldem sind in meinen Augen die Regeln des Genres. Denn auch wenn Rendel dank ihrer Verwandtschaft mit den Gestaltwandlern mit dem Motiv des Großen Kampfes verknüpft ist, spielt sie keine eigenständige Rolle in ihm. Das führt leider auch dazu, dass ihre Freundschaft mit Lyra plötzlich mehr oder weniger unter den Tisch fällt. Und die arme Tristan wird ja sogar einfach wieder zurück nach Hed verfrachtet. Alles konzentriert sich am Ende auf Morgon (und Thod).
Interessant fand ich allerdings, dass das Schicksal von Morgon und Rendel am Ende eigentlich auch ein tragisches Element enthält. In dem Moment, in dem die beiden ihre wahre Natur akzeptieren, entfremden sie sich in gewisser Weise vom Rest der Menschheit. Nach der Großen Schlacht und dem „Sieg des Guten“ kehren sie deshalb auch nicht etwa in ihre jeweilige Heimat und zu ihren Familien zurück. Man hat das Gefühl, dass sie ihre alten zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften unmöglich auf „normale Weise“ fortsetzen können. Stattdessen streifen sie ziemlich ziellos durch die Welt und scheinen nicht recht zu wissen, wie ihr „neues Leben“ eigentlich aussehen soll.
AR: Was ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis des Themas der Identitätsfindung ist, das sich ja zentral durch die drei Bände zieht.
Ich finde es auch schade, dass Rendel in Band 3 keine eigene Perspektive erhalten hat; das hätte einiges glätten können. Aber ich glaube, es waren mehrere Faktoren, die mich an Band 3 gestört haben. Beispielsweise haben die Figureninteraktionen stark abgenommen oder waren – bis auf wenige Ausnahmen wie das Wiedersehen von Morgon mit seinen Geschwistern in Hed – nur mehr Mittel zum Zweck. Stattdessen waren da diese endlosen Schilderungen zu Morgons Innenleben und wie er das Landrecht erlernt. Beides ist nicht ohne Reiz, aber wirkt irgendwann sehr repetitiv, zumal wir das zu großen Teilen schon aus Band 1 kennen. Überhaupt sind die Überschneidungen zu Band 1 stark: Wieder läuft Morgon quer durchs Reich, wieder hadert er mit seinem Schicksal, wieder spielt er auf diversen Harfen … Aber in Band 1 hatte das alles mehr Charme, weil es zum einen neu war und zum anderen andere Figuren stärker miteinbezogen waren. Hinzu kommt eben, was ich oben beschrieben habe mit den unzufriedenstellenden Beziehungsentwicklungen. Möchte aber betonen, dass ich Band 3 dennoch nicht schlecht finde. Er ist ein solider Abschluss, aber Band 1 und 2 hatten die Messlatte hoch gehängt und Band 3 fehlt es demgegenüber an eigenen Impulsen.
Antagonist*innen und die Sache mit den (Un-)Toten
PS: Ach, noch etwas zu Rendel: Ein zusätzlicher Grund, warum ich ihre Entwicklung interessanter finde als die Morgons, ist, dass wir dabei auch einen kleinen Einblick in die Natur der Gestaltwandler erhalten. Und einer der Aspekte von Erdzauber, der mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte keinen echten „Dark Lord“ besitzt und die Gegner nicht einfach monströse „Horden des Bösen“ sind. Aber bevor ich meine eigene Interpretation zum Besten gebe, würde mich interessieren, wie du die Gestaltwandler gesehen hast.
AR: Wie anfangs schon mal erwähnt, bleiben die Gestaltwandler – auch wenn Morgon ihnen letztlich einen Namen geben kann – bis zuletzt ein Mysterium. Dass sie eigentlich gar kein gezielt destruktives Interesse an den Menschen haben, sondern ihnen deren Leid nur als Mittel zum Zweck dient, macht sie auf eine Art aber weitaus bedrohlicher als all die von dir angesprochenen „Dark Lords“.
Wie schon in dem Beitrag zu den Bezügen zur keltischen Mythologie geschrieben, erinnern sie mich damit sehr an manche Darstellungen von (irischen) Anderwelt-Völkern. Sie sind die alten Fremden, von denen man im Grunde weiß, über die man aber lieber nicht zu viel nachdenkt. Und wenn man nicht aufpasst, wird man ihnen zur Spielfigur. Im Prinzip sind die Menschen aus dem Reich des Erhabenen ja „nur“ in eine Anderwelt-Auseinandersetzung hineingeraten. Zumindest ist das meine Interpretation des Ganzen.
Das für mich schockierendste Element der Trilogie war übrigens das Schicksal von Heureu, und in diesem tritt sehr gelungen heraus, was die unbewusste Bösartigkeit der Gestaltwandler ausmacht. Als sich herauskristallisiert, dass er von Gestaltwandlern entführt wurde, hatte ich zunächst zwei Vermutungen: Dass Eriel – die Gestaltwandlerin, die er geheiratet hatte, ohne um deren Wesen zu wissen – sich an ihm rächen wollte. Oder dass sie ihn retten wollte. Aber beides wären viel zu menschliche Züge gewesen. Dass sich letzten Endes herausgestellt hat, dass Heureu Eriel offenbar völlig egal war und sie ihn nur erst als Lockvogel missbraucht hat, um ihn anschließend nicht einmal zu töten, sondern einfach zum Sterben am Meer zurückzulassen, fand ich echt schmerzhaft (zumal ich Heureu mochte, aber darum geht’s hier nicht ;)). Zugleich war das eine der besten Stellen des Buchs.
PS: Die Ähnlichkeiten zu Anderswelt-Völkern der keltischen Mythologie sind mir bei früheren Lektüren ehrlich gesagt nie aufgefallen. Aber jetzt wo du’s sagst, ist das eigentlich schon ziemlich offensichtlich.
Ja, der Umstand, dass sie keinen brennenden Hass auf die Menschen zu empfinden scheinen, macht sie in gewisser Weise noch bedrohlicher. Sie stehen ihnen bloß völlig kalt und mitleidlos gegenüber. Und es ist ziemlich klar, dass in „ihrer“ Welt kein Platz für sie wäre. Deshalb ist mir auch nie in den Sinn gekommen, dass Eriel vielleicht tatsächlich irgendwelche Gefühle für Heureu hegen könnte. Für mich bestand an diesem Punkt kein Zweifel mehr daran, dass Menschenleben für die Gestaltwandler keinerlei Wert besitzen.
So gesehen kann man sie sicher als „böse“ bezeichnen. Doch was mich so an ihnen fasziniert ist, dass sie zugleich mit Motiven von Schönheit und Melancholie verknüpft werden. Wenn Eriel Rendel einen ersten Einblick in die Macht gibt, die ihr dank ihrer Verwandtschaft mit den Gestaltwandlern gegeben ist, formt sie aus Feuer wunderschöne, filigrane Figürchen. Gut möglich, dass ich da zum Teil Sachen in den Text hineinlese, die gar nicht drin stehen, aber für mich sind die Gestaltwandler so etwas wie anarchische, amoralische Ästheten. Sie sehen die Welt als eine Spielwiese, als Material, das sie nach ihren Wünschen formen und gestalten können. Und sie sind nicht bereit, sich dabei irgendwelchen Regeln zu unterwerfen, Rücksicht auf das Leben anderer zu nehmen oder sich in der Anwendung ihrer Macht irgendwie einzuschränken. Im Grunde verlangt es sie nach absoluter Freiheit. Doch wir erleben sie ja nur im Zustand ihres Exils. Und das umgibt sie irgendwie auch mit einem melancholischen Hauch. Mit Rendel können wir ein wenig die Trauer um und Sehnsucht nach ihrer verlorene Herrlichkeit nachempfinden, die sie erfüllt. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass ihr Exil motivisch mit dem Meer verknüpft wird. Denn das Meer ist einerseits – zumindest für mich – immer von einer leicht melancholischen Atmosphäre umgeben, verkörpert andererseits aber auch sehr schön die ungezügelten Naturgewalten.
AR: Diesen melancholischen und ästhetisch interessierten Touch finden wir ja bei vielen „alten Völkern“, sowohl aus dem mythologischen Bereich als auch aus der Gegenwartsfantasy. Denke da beispielsweise an einige Elfeninterpretationen (z. B. aus der Geralt-Saga), an die Vampir-Sidhe aus der Judaskinder-Trilogie oder die Irda der Drachenlanze-Saga. Mit letzteren haben die Gestaltwandler auch gemein, dass sie mehr oder weniger an ihrer eigenen Macht zerbrochen sind, wenn auch das dekadente Moment fehlt (bzw. wir es nur hineininterpretieren können). Als „anarchisch“ oder „amoralisch“ sehe ich sie aber nicht. Sie sind anders, aber im Grunde wissen wir nicht, welche Werte oder Ansichten sie aus ihrer eigenen Logik heraus vertreten. Umso mehr gilt das, da sie vom Erhabenen in einer Art geistigen Bann gehalten werden, den sie bis zum Ende nicht ganz abstreifen können.
Wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, den ich einerseits interessant, andererseits aber auch etwas schade fand. Dadurch wurde mir nie ganz fühlbar, welchen Reiz sie auf Rendel ausüben. Die Sehnsucht, die von ihrer Macht ausgeht, kann ich nachvollziehen. Auch die Verheißung auf eine … mystische Heimat, die Ylon dazu gebracht hat, sich ins Meer zu stürzen, und damit ins Reich der Gestaltwandler, fand ich nachvollziehbar. Aber nicht, worin der Reiz für Rendel lag, nachdem sie Eriel kennengelernt hatte. An einer Stelle fragt sich Rendel das sogar selbst, aber es ist schade, dass wir darauf nie so richtig eine Antwort erhalten. Wäre vielleicht auch anders gewesen, hätte Rendel eine eigene Perspektive in Band 3 erhalten.
Aber apropos Ylon: Er ist eine von vielen Figuren, deren Tod eine ziemlich relative Sache ist. Er taucht ja selbst nie aktiv auf, ist nur eine beliebte In-Story-Sagenfigur, da er das (soweit wir wissen) erste Kind einer Menschenfrau und eines Gestaltwandlers war. Er ging ins Meer, was sich zunächst als Suizid interpretieren lässt. Später kehrte er aber zurück, um die Landherrschaft anzutreten, ehe er sich von einem Turm stürzte (was dieses Mal vermutlich wirklich seinen Tod bedeutet hat). Doch generell ist der Tod gerade in An keine sichere Angelegenheit – hier ist es völlig selbstverständlich, dass des Nachts Untote herumlungern, die einem auch schon mal ein Schwätzchen aufdrücken. In den anderen Ländern ist das zumindest unüblicher. An einer Stelle merkt jemand lakonisch an, er sei froh, in Hed zu leben, wo die Toten einfach tot bleiben. Dass das in An aus irgendeinem Grund anders ist – ok, von mir aus, An ist ja eh ziemlich magisch veranlagt. Wobei man auch sonst vereinzelt auf Leute trifft, die irgendwo zwischen Leben und Tod feststecken.
Mich würde interessieren, was das über das Selbstverständnis und den Totenglauben der Leute aussagt. Wie erklären sie sich, dass einige „weiterziehen“, andere nicht? Ist es für sie ein Trost, dass es offenbar eine Form des Danach oder des Dazwischen gibt? Zumindest werden der Tod und das Töten als etwas sehr Einschneidendes beschrieben, ohne dass darauf aber mehr eingegangen würde. Vor allem zu Ende der Trilogie, als einige liebgewonnene Figuren im Kampf gegen die Gestaltwandler gefallen sind, hatte ich da auf ein paar mehr Worte zu gehofft. Wer stirbt, unterliegt nicht länger der Macht des Erhabenen. Aber wessen Macht dann? Oder gibt es tatsächlich einen „endgültigen“ Tod? Auch das ist eine dieser offenen Fragen, bei denen ich es einerseits spannend, andererseits aber auch schade finde, dass sie gar nicht angesprochen werden.
PS: Das „anarchische“ leite ich mir aus den Gründen für den ersten Großen Krieg ab. Die Gestaltwandler wollten ihre Macht nicht den Gesetzen des Landrechts unterwerfen. Aber wie gesagt, da lese ich vielleicht Sachen in den Text hinein, die gar nicht drin stehen.
Was den Tod betrifft: Mein Eindruck war, dass er für die Menschen des Reiches im Normalfall tatsächlich das Ende bedeutet. Oder zumindest sowas wie einen Ewigen Schlaf. Von einem Jenseits ist, soweit ich mich erinnern kann, nie die Rede. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es keine Religion zu geben scheint. Da folgt McKillip ganz dem Vorbild des Lord of the Rings. Zwar wird vom Erhabenen manchmal wie von einem Gott gesprochen. So etwa, wenn Morgon und die anderen sich fragen, warum er nie eingegriffen hat, um das Übel zu bekämpfen, das seit Jahrhunderten in seinem Reich heranwächst. Aber letztlich wissen die Leute doch, dass er kein übernatürliches Wesen, sondern bloß der letzte der Erdherren, also der einstigen Bewohner des Landes, ist. Das Ausmaß seiner Macht bleibt zwar (wie so vieles) vage, aber wie du ja auch sagst, geht sie sicher nicht über das Leben in dieser Welt hinaus.
Die Toten von An waren für mich ein Sonderfall. Bei denen handelt es sich ja ausnahmslos um die Könige und Krieger, die in den alten Fehden zwischen den drei Reichen gefallen sind. Und für gewöhnlich streifen sie auch nicht nachts durch die Wälder, erschrecken das Vieh oder verwüsten irgendwelche Äcker. Das tun sie bloß, weil König Mathom sein Reich zu lange allein gelassen hat. Eigentlich stehen sie unter einem Bann. Wie ich anfangs schon mal gesagt hab, sehe ich in ihnen vor allem eine Verkörperung der blutigen Vergangenheit des Landes. An wurde mit Gewalt zusammengeschweißt und muss – zumindest auf einer „spirituellen“ Ebene – auch mit Gewalt (oder zumindest strenger Autorität) zusammengehalten werden, sonst brechen die alten Fehden wieder aus. Das Fortleben der Toten von An hat darum auch eher den Charakter eines Fluchs, finde ich. Dasselbe gilt für den ollen König Peven, der Jahrhunderte lang in seinem Turm hockt und Rätselkämpfe ausfechtet. Wird von dem nicht sogar angedeutet, dass er sich wünscht, nach seiner Niederlage gegen Morgon endlich von diesem Bann befreit zu werden?
Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob Peven tatsächlich ein Untoter ist. Denn eine weitere Merkwürdigkeit dieser Welt ist es ja, dass es einige Menschen gibt, die ein jahrhundertelanges Leben besitzen. Die Zauberer, die Könige Har und Dannan. Niemand scheint das irgendwie ungewöhnlich zu finden. Ist halt so. Und niemand stellt die Frage, warum denn gerade sie so langlebig sind. Mit ihren magischen Talenten hat das anscheinend nicht wirklich was zu tun, denn Mathom flattert ja auch gerne mal als Krähe durch die Gegend, und doch scheint den Königen von An kein unnatürlich langes Leben gegeben zu sein.
AR: Ich habe Peven schon als Untoten interpretiert, meine auch, er würde als solcher bezeichnet. Aber ja, da sind zweifellos einige Unklarheiten. Man kann sich ja auch fragen, warum An diesen, wie du ihn bezeichnest, „Fluch“ auf sich geladen hat, Ymris aber nicht – obwohl auch da immer mal erwähnt wird, dass das Land einige Fehden hinter sich hat und das Land ja sogar auf Boden der alten Erdherren-Stätten gebaut wurde. Aber da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion: Als Leser*in muss man akzeptieren, dass diese Merkwürdigkeiten eben Teil des Weltenbaus sind. Ansonsten wird man mit der Trilogie keinen Spaß haben.
„Wenn Voiha erwacht“ und Erdzauber – ein Vergleich
AR: Abschließend würde ich gerne einen kleinen Vergleich zu Joy Chants „Wenn Voiha erwacht“ ziehen, was wir ja letztes Jahr einem Reread unterzogen hatten. Beide sind eigentlich sehr unterschiedlich, allein schon von der Länge her: Erdzauber ist ein dreibändiges Questen-Epos, das sich viel um Identitätsfindung in einer ausgearbeiteten, dichten Welt mit plotrelevanter Vergangenheit dreht. „Wenn Voiha erwacht“ ist dagegen eher ein Social-Fantasy-Kurzroman, der ohne magische Komponenten auskommt, nur die wichtigsten Handlungsorte erklärt (und auch die eher rudimentär) und Themen der Einflussnahme und gesellschaftlichen Macht behandelt. Trotzdem sind Chant und McKillip für mich Autorinnen derselben Ära – Erdzauber erschien von 1976 bis 1979, „Wenn Voiha erwacht“ 1984 – und ich habe sie immer in einem Zuge genannt. Was vermutlich auch daran liegt, dass sie beide damals in der schwarzen Goldmann-Fantasyreihe erschienen sind; in Erdzauber 2 und 3 ist in der Originalausgabe hinten auch Werbung für Joy Chants Bücher enthalten.
Rückblickend finde ich, dass beide grundsätzlich gut gealtert sind. Stilistisch bräuchten beide eine Überarbeitung und wahrscheinlich würde heute u. a. der Mangel an Actionszenen bemängelt. Aber sie umschiffen einige Problematiken ihrer Zeit – ich denke da z. B. an den Pathos oder stark kolonialistische Elemente, wie sie so einige andere Fantasyromane aufweisen – und es ist nicht nur Nostalgie, was heutige Leser*innen (meiner Meinung nach) ansprechen könnte. Erdzauber punktet in dieser Hinsicht eher durch die Form des Textes, die durch Dialoge transportierten Figurenbeziehungen und den leicht ironischen Ton, der auch viele aktuelle Werke begleitet. Die Stärken von „Wenn Voiha erwacht“ liegen dagegen im Social-Fantasy-Ansatz; der Themenkomplex rund um Matriarchat bzw. Patriarchat und auch Klassismus würde zu heutigen Debatten ebenfalls gut passen, auch wenn die Geschichte selbst aus heutiger Sicht zu passiv erzählt wirkt.
Wie siehst du das?
PS: Uff, da setzt du mir zum Abschluss aber noch einmal eine Frage vor …
Mir fällt es grundsätzlich schwer, zu beurteilen, ob ein Buch oder eine Story heute noch „funktioniert“. Vor allem, wenn’s dabei um den Sprachstil geht. Ich selbst lese halt sehr oft ältere Sachen und hab nie ganz kapiert, wie Stile „veralten“ können. Da scheint mir immer die Idee hinterzustehen, dass es so etwas wie „kontinuierlichen Fortschritt“ in Literatur und Kunst geben würde. Was ich für Blödsinn halte. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es wandelnde Moden gibt. Und gerade bei „Voiha“könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielen heute vielleicht etwas zu überladen vorkommen würde. Bei Erdzauber ist es allerdings gerade die Sprache, die für mich einen Gutteil des Reizes ausmacht. Ob die auf jüngere Leser*innen noch genauso wirken würde, kann ich natürlich nicht sagen. Ich hoffe es …
Und ja, die fehlenden Actionszenen wären für manche vielleicht ein Problem. Bei „Voiha“ gibt’s die ja überhaupt nicht und auch bei Erdzauber spielen sich die richtig großen Schlachten und so irgendwo abseits der eigentlichen Handlung ab. Hinter dem Horizont sozusagen. Andererseits beweist der erfreulich große Erfolg von so Büchern wie Becky Chambers‘ Wayfarer-Romanen ja doch, dass es auch heute nicht immer Äktschn und Gemetzel braucht. Ist natürlich keine Fantasy …
Was die thematische Seite angeht, sehe ich das bei Wenn Voiha erwacht eigentlich genau so wie du. Erdzauber könnte es da vielleicht schon etwas schwerer haben. Trotz vieler Eigenheiten, die die Trilogie von den typischen 80er Jahre-Endlos-Epen abheben, ist sie letzten Endes halt doch klassische High Fantasy mit allem, was dazu gehört: Auserwählter Held, Queste, Prophezeiungen, der Große Kampf um das Schicksal der Welt. Das könnte auf manche heute vielleicht schon etwas abschreckend wirken, keine Ahnung.
Andererseits gibt’s in Erdzauber keine der ollen Standard-Fantasyvölker. Keine Elfen, keine Zwerge, keine Hobbit-Ersatze. Und als Folge davon wird hier auch niemand über seine „Rasse“ definiert. Außer den Gestaltwandlern natürlich … Überhaupt ist die Trilogie erfreulich frei von einigen der „problematischeren“ Aspekte älterer Fantasyliteratur. Selbstverständlich könnte man argumentieren, dass die Welt von McKillips Epos extrem „eurozentrisch“ ist. Das Reich des Erhabenen ist ja ein sehr überschaubares und völlig in sich abgeschlossenes Universum, dessen kulturelle Vorbilder alle irgendwie europäisch sind. Was jenseits der Grenzen des Reiches liegt, erfahren wir nie. Anscheinend nur menschenleere Wildnis. Mit ethnischer Diversität kann Erdzauber also sicher nicht punkten. Dafür bekommen wir aber auch keine der damals so geläufigen rassistischen oder orientalistischen Klischees serviert. Keine wilden Reiterstämme aus den Steppen des Ostens, keine schwarzen Haradrim mit Goldschmuck und Kriegselefanten, keine turbantragenden Wüstenbewohner mit ihren Harems und Szimitaren. Und da die Gestaltwandler keine generischen „Horden des Bösen“ sind, bleiben auch sie frei von derartigen Zügen. Zum Vergleich muss man nur einmal einen Blick in Terry Brooks‘ beinah zeitgleich erschienenes Sword of Shannara werfen. Die Gnomen, die da als Orkersatz dienen, gleichen bis aufs Haar irgendwelchen „wilden Eingeborenenstämmen“ aus einem 30er-Jahre-Pulp-Roman …
Und natürlich ist auch eine derart komplexe und eigenständige Frauenfigur wie Rendel in der Fantasy der Zeit nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
So gesehen kann ich es mir schon vorstellen, dass Erdzauber auch heute noch genug Leser*innen begeistern könnte, die keine nostalgischen Gefühle für die Trilogie hegen. Es würde mich jedenfalls freuen.
AR: Was den Stil angeht, gibt es halt so Regeln wie show don’t tell, die heute eine viel zentralere Rolle einnehmen als in den 1970er und 1980er Jahren. Mittlerweile wird diese Regel zwar auch wieder aufgebrochen, aber gerade bei Joy Chant fiel mir letztes Jahr stark auf, wie es mir durch die vielen Beschreibungen schwer fiel, die Distanz zwischen mir als Leserin und den Figuren zu überbrücken. Bei McKillip hatte ich da überhaupt keine Probleme.
Übrigens habe ich eben gesehen, dass 2006 bei Heyne eine Neuübersetzung der Trilogie herausgebracht wurde. Aus Sicht von Erstleser:innen fallen die Rezensionen aber eher durchwachsen aus, ähnlich wie in der Neuauflage von Gollancz aus dem Jahr 2015 – immer wieder heißt es da, die Trilogie sei konfus und handlungsarm. Ich frage mich, ob ich das auch so sehen würde, wenn ich nicht diesen ganzen nostalgiegesättigten Background hätte. Tja, wir werden’s nie wissen, und ich spreche an alle, die nicht alle paar Seiten ausgedehnte Kampfszenen brauchen, dennoch eine Leseempfehlung aus. (Die alte Übersetzung soll aber besser sein; just sayin‘.) Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, die Trilogie erneut zu lesen, dieses Mal mit all dem Genre-Hintergrundwissen. Ok, wen knöpfen wir uns nächstes Jahr dann vor …? 😉