Und immer wieder der Idealismus: Über das Schreiben
Der nachfolgende Text ist Teil einer von der Zeitzeugin initiierten Essay-Sammlung zum Thema „Schreiben“. Den Sammelbeitrag dazu findet ihr hier.
Vor ein paar Wochen wurde ich in einem Interview gefragt, ob ich vom Schreiben leben könne. Nun. Ja. Kann ich momentan. Aber nicht so, wie sich das der Fragensteller vermutlich vorgestellt hat.
Ich sitze acht Stunden in einem Büro und schreibe. Ratgebertexte und Newsletter, Didaktisierungen und Testfragen. Dann komme ich heim und schreibe weiter. Über Studiengänge und Einkaufscenter und – ja, hin und wieder auch über die Abenteuer fiktiver Menschen in anderen Welten.
Mit anderen Worten – ich arbeite als Redakteurin und nebenher freiberuflich als Autorin und gelegentliche Texterin. Eigentlich eine recht klischeehafte Kombi für nebenberufliche Schriftsteller. Aber offen gestanden nicht die Optimalste.
https://twitter.com/adampknave/status/626066717270151168
Euch die Violine, mir das Schreiben
Lange war das Schreiben für mich einfach ein Hobby. Andere haben gezeichnet, Violine oder Tennis gespielt oder sind regelmäßig in der Disse versackt, ich habe eben geschrieben. Angefangen hat es mit Kurzgeschichten über Leute, die ihre Kamele suchen. Entwickelt hat es sich mit Rezensionen und den obligatorischen Teenie-Manuskripten. Professionalisiert wurde es durch Reportagen und die Veröffentlichung von „Vor meiner Ewigkeit“.
Nachdem das Buch erschienen war, wurde ich oft gefragt, wie ich neben dem Studium noch dazu käme, Bücher zu schreiben. Ich habe nicht verstanden, worin die große Herausforderung dabei liegen sollte. Klar, wenn gerade etwas mit Frist anstand (z. B. eine Überarbeitung), konnte das in Verbindung mit Klausurzeiten oder Seminararbeiten schon einmal stressig werden. Aber grundsätzlich waren das Schreiben – auch oder besonders das fiktive/belletristische – und auch der Rattenschwanz, den das mit sich zog (Social Media, Blogging, Lesungsorganisation) immer noch mein Hobby. Ich habe damit oft vier Stunden täglich verbracht und war vollkommen zufrieden. Es war ja auch nicht so, dass irgendein Druck von außen bestanden hätte – „Vor meiner Ewigkeit“ stand zu großen Teilen schon vor meinem Studium und danach warteten kaum weitere Verpflichtungen. Ich konnte schreiben, wann ich wollte, was ich wollte und wie ich wollte.
Alles für den Idealismus
Nach meinem Studium wollte ich ursprünglich Museumspädagogin werden. Das hatte ich ein paar Mal ausprobiert, es war irgendwie nett, hatte sich als ideale Inspiration und als praktischen Ausgleich zum Schreiben erwiesen. Allerdings leidet man als Schriftsteller ja unter chronischem Idealismus. Bei einigen führt das dazu, dass sie krass unterbezahlte Jobs annehmen, nur um mit Kunst und Kultur zu tun zu haben. Bei mir hat es das Gegenteil bewirkt: Praktika und die Arbeitsbedingungen von Volontären und Aushilfen haben mich angewidert und ich bekam Angst, meinen Idealismus zu verlieren, wenn ich mich auf sie einlasse.
Stattdessen bin ich also zu meiner eigenen Überraschung als Volontärin in einer Redaktion gelandet. Gewissermaßen ist es recht befriedigend, von dem leben zu können, was man gut kann. Allerdings fallt es mir seitdem schwerer, das andere Schreiben noch als Hobby zu begreifen. Manchmal frage ich mich, weshalb ich damit trotzdem weitermache, wenn ich abends oder am Wochenende manchmal viel lieber etwas machen würde, wobei ich mal nicht mit Worten jonglieren und Bildschirme anstarren muss. Ich denke, die Antwort lässt sich grob in drei Teile aufspalten:
1. Eine Frage der Erwartung und Professionalität
Als Kleinverlagsautor wird einem in der Regel nicht viel Aufmerksamkeit zuteil. Wenn die Bestehende ausbleibt, weil man lange nichts von sich hat hören lassen, fällt es dann umso mehr auf. Und auch, wenn man sich einredet, es mache einem nichts aus, macht es das doch. Man hat es einmal geschafft, reinzukommen, Leser zu erreichen (egal, ob mit Romanen, Kurzgeschichten oder Artikeln), Verlage auf sich aufmerksam zu machen. Auch wenn man nicht zwangsläufig darauf angewiesen ist, will man das nicht verlieren, nicht enttäuschen, den Fuß nicht auf der falschen Seite der Tür herausziehen. Und man will besser, professioneller werden. Weil es gut ist, dass das Schreiben inzwischen mehr als ein Hobby ist. Weil es eine Form der Bestätigung bedeutet (es kann ziemlich faszinierend sein, festzustellen, dass das eigene Geschreibsel überhaupt jemanden interessiert!).
Vielleicht spielt dabei auch die leise Hoffnung mit, irgendwann doch einmal von dieser Art des Schreibens leben zu können. Obwohl man sich gar nicht sicher ist, ob es nicht besser ist, die Finanzfrage an etwas zu binden, an dem man nicht mit Leib und Seele hängt.
2. Eine Frage der Leidenschaft
Manchmal, wenn mir alles über den Kopf zu wachsen droht, ziehe ich die Reißleine. Versuche zwei, drei Wochen zu pausieren. Aber dann fange ich wieder an. Meistens nicht, weil Fristen anstünden oder ich irgendeinen Druck von außen verspüren würde. Sondern weil ich die Tätigkeiten zu vermissen beginne. Den Blog, auf dem ich mich sprachlich und inhaltlich austoben kann, der nach meinen eigenen Regeln lebt. Die Autorengruppen, in denen ich mich über herrlich absurde Probleme austauschen kann. Und die Geschichten, deren Weiterspinnen ich mir ohnehin niemals verbieten kann oder will. Man schreibt all das ja nicht, wenn man nicht eine gewisse Leidenschaft dafür empfindet. Ich liebe das kreative Schreiben mehr denn je und es gehört zu mir, auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit dafür aufbringen kann wie früher. Und ich schätze die Phantastikszene, in der ich mich trotz phasenweiser Befremdungen noch immer erstaunlich wohl fühle.
3. Eine Frage der Freiheit (Pathos, Baby!)
Phantasten hin oder her. Was immer bleibt, ist das Gefühl des Fremdseins, gleich, zu wie vielen Foren und Vereinen, Magazinen und Blogs ich meinen Senf beitrage. Ich akzeptiere es, ebenso wie ich inzwischen akzeptiere, Kompromisse eingehen zu müssen. Aber das Schreiben der Geschichten & Co. muss bleiben. Und wenn ich mich frage, ob es intelligent ist, einen solchen Text zu veröffentlichen, muss es umso mehr sein. Damit ich das Fremdsein nicht vergesse. Damit ich mir selbst nicht fremd werde. Es ist die kleine Rebellion, die sein muss, die Selbstvergewisserung, sich nicht verloren zu haben zwischen Texten, die nicht zu einem selbst gehören. Es ist die vielleicht etwas narzisstische Freiheit, zu tun was man selbst für richtig hält, etwas mit eigenem Sinn zu produzieren und damit sogar Menschen zu erreichen.
[Text unter CC BY-ND 3.0 DE]
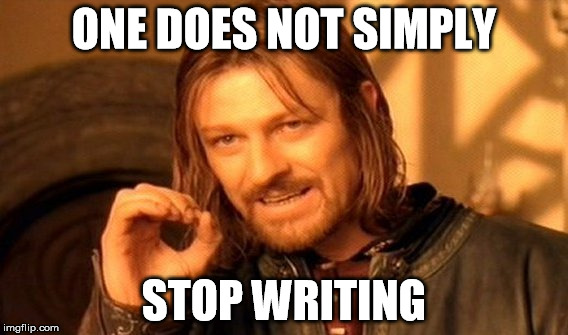
13 Gedanken zu „Und immer wieder der Idealismus: Über das Schreiben“
Das ist wirklich sehr interessant. ich muss sagen, ich beneide dich ein wenig, weil du den ganzen Tag mit Schreiben verbringst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein „zuviel des Guten“ werden kann.
Das Gefühl des Fremdseins, das kenne ich auch. Ich glaub, es war Isabel Allende, die mal gesagt hat, das Fremdsein ist das, was Autoren zum schreiben drängt. Das man quasi am Rand steht und Fragen stellt, auf die keiner kommt, und die als komisch abgetan werden. Und dass man anfängt zu schreiben, um die Fäden zumindest im eigenen Kopf zu verknüpfen. .. in dem Sinne, ich wünsche dir noch ganz viele tolle Ideen für Blog und Geschichten ….
und warum haben die Kamele ihre Leute gesucht???
Danke 🙂
Die Idee gefällt mir mit dem Schreiben durchs Fremdsein. Dasselbe hat irgendeine Ethnologin, deren Name mir gerade nicht mehr einfällt, auch mal über ihren Berufszweig gesagt. Es ist wahrscheinlich nicht von ungefähr so, dass Autoren und Hardcore-Ethnologen gerne als etwas wunderlich betrachtet werden 😉
Was die Kamele angeht: Als Grundschulkind hatte ich mir mal ein Foto aus der Zeitung ausgeschnitten, auf dem ein Mann sein weggelaufenes und wieder aufgetauchtes Kamel geknuddelt hat. Ich fand das wohl sehr inspirierend und hab den beiden Abenteuergeschichten angedichtet. Das waren meine ersten Kurzgeschichten, an die ich mich erinnern kann, deshalb die Sache mit den verlorenen Kamelen 😉 (Auch wenn es eigentlich nur EIN Kamel war.)
Der Grund warum ich mit Werbung aufhören musste und wieder anfing Filme zu machen, die zumindest mich interessieren. Danke für das Erinnern. Wer schreibt, der/die bleibt ?
Huppsa, ich hatte die Antwort unter dem falschen Kommentar platziert -_-
Ein bisschen ironisch, dass das gerade in den “kreativen” Berufen recht verbreitet zu sein scheint, dass man früher oder später die Kompensation der freiwilligen Kreativität braucht, wa.
Ich kenne das so gut, allerdings vom Zeichnen und mir hat es echt das kreative Genick gebrochen. Da bin ich froh, dass es bei dir nicht so ist 🙂
Genau, was ist mit den Kamelen? =_= *g*
Oh, mach mir keine Angst 😮 Ich mach das ja erst seit 10 Monaten, wer weiß, was da noch kommt …
Kamele – siehe die Antwort eins drüber 😉
Schön das mit der kleinen Rebellion. Das kenne ich. Immer wenn ich vereinnahmt werden sollte, ging ich einen Sonderweg. Der war nicht immer erfreulich, aber dafür nötig.
Du sprichst genau die Punkte an, vor denen ich auch etwas Angst habe. Sollte ich mich tatsächlich wagen mich mit dem Schreiben selbstständig zu machen? Es klingt verlockend, aber wie du so schön sagst: alles dreht sich dann nur noch um Wörter und Bildschirmarbeit. Deine Betrachtung gefällt mir und ich bin mir sicher, dass du auch in Zukunft deine Kreativität bewahren kannst. Das hoffe ich für mich natürlich auch. Bei dir entsprechendes zu Lesen macht mir daher Mut es auf jeden Fall zu wagen.
Der Gedanke mit dem Fremdsein ist mir allerdings neu. Finde ich interessant. Ein neuer Blickwinkel ist immer wieder wichtig.
Danke für deinen Einblick.
Alles Liebe
Eluin
Hey Eluin,
schön, dich hier zu lesen ^-^
Ich denke, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Klingt nach einer Binsenweisheit, aber so ist es ja … Arbeitet man hauptsächlich als Arbeitnehmer, hat man mehr Sicherheit, aber auch mehr Einschränkungen; arbeitet man selbstständig, hat man mehr Freiheiten, aber auch Ungewissheiten. Arbeitet man den ganzen Tag als Autor, macht man sein Hobby zum Beruf, riskiert aber, vom Kreativen zum Fließband-Wortschreiber zu werden. Sucht man sich etwas anderes, hat man vielleicht wiederum das Gefühl, etwas zu verpassen.
Wahrscheinlich muss man ein bisschen herumprobieren, bis man den idealen Weg für sich findet. Wir bekommen das schon noch hin 😉