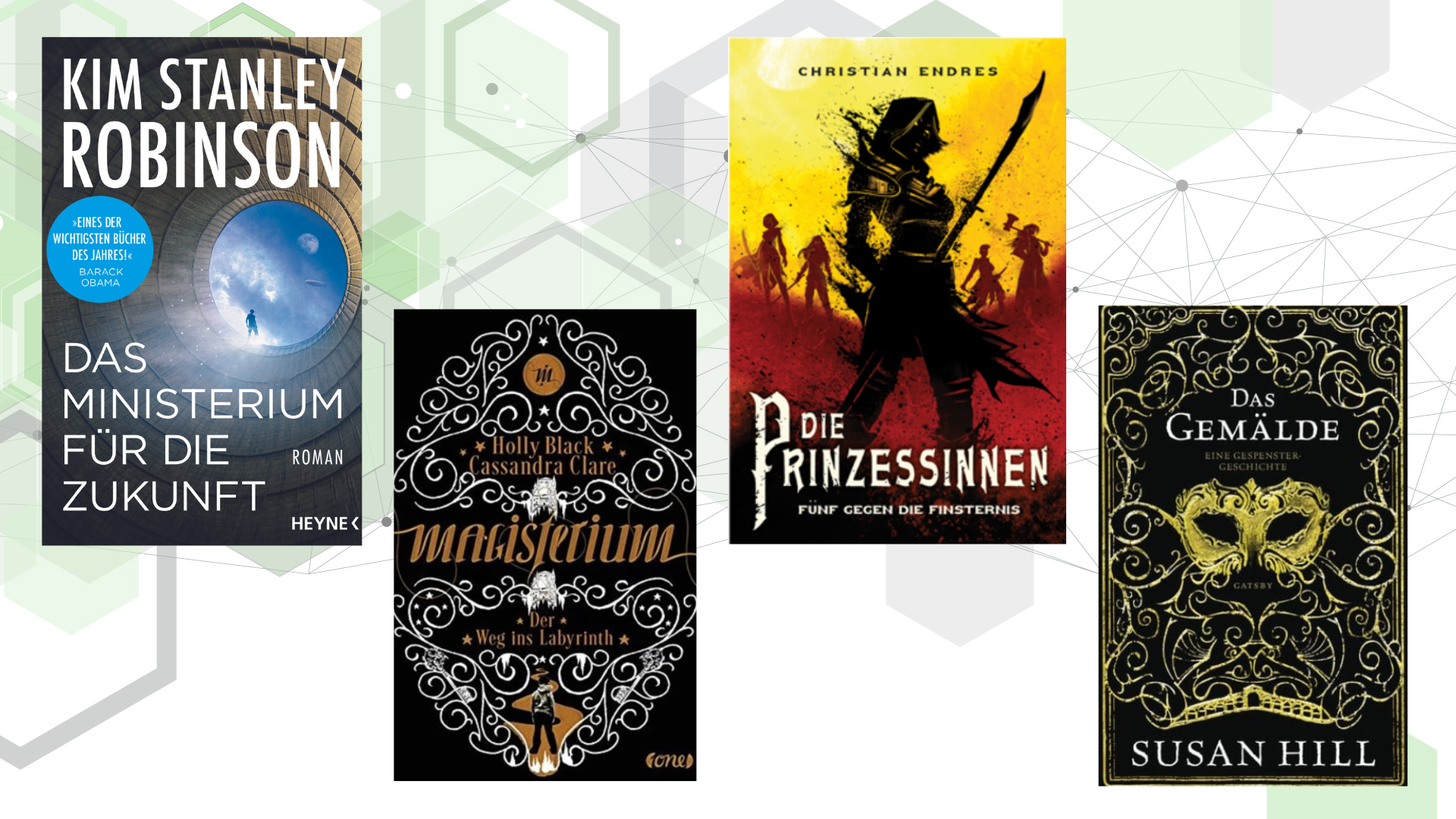
7+7 Buchansichten 2023, Teil 2
Der letzte Tag des Jahres ist da und mein Leserückblick jetzt dann auch. Lieber spät als nie, wa. Ehe ich aber schamlos die Werke anderer Leute kritisiere, zunächst ein kurzer Blick auf mein Jahr als Autorin:
Es war … existent. Gelegentlich zumindest. Ich habe einen Roman mit-veröffentlicht, „Das Königsgift“ und einen zweiten – „Spielende Götter“ – neu aufgelegt.* „Die Türme von Eden“ wurde hingegen aus der Print-Landschaft gezogen.
Im letzten Jahr um diese Zeit habe ich eine Urban-Fantasy-Novelle verfasst, diese 2023 überarbeitet und vor ein paar Wochen einem Verlag angeboten. Ob er Interesse hat, wird sich zeigen. Eine Kurzgeschichte ist ebenfalls entstanden, sie wird 2024 oder 2025 erscheinen. Neue Romanprojekte habe ich jedoch keine verfolgt und die Großbaustelle „Getreidefantasy / Grainpunk“ Anfang des Jahres auf Eis gelegt. Über das Warum habe ich kürzlich im Adventskalender ein paar Zeilen verloren.
In den letzten Tagen sind ein paar Notizen für ein neues Projekt in alter Welt entstanden; ob es die Zeit nach dem Kreativitätsschub zwischen den Jahren überdauern wird? Wir werden sehen.
Grundsätzlich habe ich in diesem Jahr eine gewisse Müdigkeit in Bezug aufs Veröffentlichen verspürt. Positiver gesprochen, könnte man von Gleichmut sprechen. Ich habe das Spiel in dieser Runde nicht gewonnen, auf der Zuschauerperspektive ist es aber recht entspannt.
Und wo weniger geschrieben wird, ist zumindest mehr Zeit zum Lesen. Mein entsprechender Rückblick zum ersten Halbjahr ist bereits im Juli erschienen, danach ging es solide weiter. Wobei mir beim Sammeln der Titel für dieses Posting auffiel, dass es nicht ganz so solide weiterging, wie ich dachte. Denn ich habe zwar viel gelesen, aber entgegen früherer Gewohnheit so viel parallel, dass ich deutlich weniger Romane auch tatsächlich beendet habe. Hier liegt ein schöner Stapel von Büchern mit Lesezeichen, von denen ich 90 % plane, noch zu Ende zu lesen, aber … nun, das Ende ist noch nicht erreicht. Außerdem waren einige Anthologien dabei, die ich ohnehin selten am Stück lese, und ein französischer Fantasyroman, bei dem ich 50 % der Zeit damit beschäftigt bin, Begriffe nachzuschlagen. Ich verstehe zwar auch ohne Nachschlagen, was passiert, aber mir gehen die Details verloren, und sowas nervt mich – daher lese ich auch selten Romane auf Englisch.
Kommen wir dann aber mal zu sieben Titeln, die ich tatsächlich von vorne bis hinten gelesen habe:
(1) Mehr Solarpunk als Solarpunk: Kim Stanley Robinsons „Das Ministerium für die Zukunft“
2023 habe ich sehr viele Titel aus den Bereichen Climate Fiction und Solarpunk gelesen; ich sage zwar immer, dass für mich vornehmlich die sozialen Strukturen von Solarpunk interessant sind, aber da sich die in Wechselwirkung mit der Literatur ergeben, muss halt auch mal ein Blick in diesen Korpus sein.
Kim Stanley Robinson war eigentlich bereits Anfang des Jahres dran, und das gleich doppelt: mit „Das Ministerium für die Zukunft“ und mit der Essay-Sammlung „Erzähler des Klimawandels“, herausgegeben von Fritz Heidorn im Hirnkost Verlag. Seither wollte ich ein eigenes Posting dazu verfassen, und darin u. a. darauf eingehen, warum „Das Ministerium …“ für mich mehr Solarpunk ist als der meiste Solarpunk. Aber das ist die Art von Beitrag, für die mir in diesem Jahr Zeit und Muse gefehlt haben. Stattdessen habe ich das Thema u. a. bei den Wetzlarer Tagen der Phantastik, beim Solarpunk-Seminar an der RUB und im entsprechenden phantastisch! 92-Beitrag angesprochen. Um es auch hier mal erwähnt zu haben: „Das Ministerium für die Zukunft“ ist wütender Optimismus, weit entfernt von der Behaglichkeit der Postapokalypse-Utopien einschlägiger Anthologien. Denn hier wird die Herausforderung des Wegs beschrieben, nicht des Ziels, und der ist von Widerständen gepflastert, Macht oder Bequemlichkeiten für das Wohl des Planeten aufzugeben. Auf der anderen Seite steht aber eben auch die Weigerung, deshalb aufzugeben – Hopepunk galore! Zudem ist das Buch episodenhaft erzählt, es vermischt Fiktion und Sachbuch und bietet eine Vision mit nachhaltigen, regenerativen Technologien, Open-Source-Utopien und einer postkapitalistischen, kosmopolitanischen Weltgemeinschaft. Es sei Robinson gegönnt, dass er sich im Interview mit dem Solarpunk Magazine der Einordnung in Hope- oder Solarpunk als Bewegung verwehrt; von mir aus sei es ebenso italienischen Herausgebern gegönnt, dass sie Robinson hiervon explizit ausschließen. Schaut man auf die literarische Seite, kann man das Buch dank der genannten Faktoren aber prima als Solarpunk lesen. Na gut, zumindest als old school solarpunk von der pragmatischen Art, wie er auch bei Roberta Spindler auftaucht. Für die Post-2019-Variante kommt der Diversitätsaspekt im Roman zu kurz. Robinsons Essays wiederum merkt man ohnehin an, dass er nicht umsonst als einer der (unfreiwilligen) Gründungsväter der Bewegung gilt.
Oh, abgesehen davon ist „Das Ministerium …“ aber auch einfach gut geschriebene und clever verflochtene Climate / Eco Fiction. Allem geschilderten Ökoterrorismus zum Trotz wirkt es ironischerweise aus heutiger Sicht schon fast wieder zu utopisch, da Corona, der Angriffskrieg auf die Ukraine und alles, was sozial daran hängt, in der Near-Future-Handlung nicht auftauchen. Aber das kann man dem Buch kaum vorwerfen. Dass es durch den Mix aus Episodenroman und Sachbuch „unlesbar“ sei, wie manche Rezension behauptet, kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Es ist ungewohnt, strukturell progressiv. Gleichwohl spannend.
„Das Ministerium für die Zukunft“ von Kim Stanley Robinson, Heyne 2021, ISBN: 978-3-453-32170-0
(2) Buddy & Sorcery: „Die Prinzessinnen: Fünf gegen die Finsternis“ von Christian Endres
Auf dieses Buch habe ich mich gefreut, seit ich die erste Ankündigung gelesen habe, denn es klang nach Buddy-Fantasy und ich mag Buddy-Fantasy: Im Zentrum der Handlung steht Prinzessin Narvila, die von vier Söldnerinnen aus den Klauen einiger Ganoven gerettet wird und sich der Truppe daraufhin kurzerhand anschließt. Was folgt, ist ein munteres Geschnetzel durch monsterverseuchte Lande.
Auch hier ist die Handlung – Sword&Sorcery-typisch – trotz eines roten Fadens episodenhaft erzählt, was ich stets zu schätzen weiß. Das Buch lebt vom nicht immer problemfreien Miteinander der fünf (Anti-)Heldinnen, deren Origin Stories nach und nach aufgedeckt werden, und von ihrem Alltag, in dem Monster, finstere Kerle, Dämonenköniginnen und die Konkurrenz verdroschen werden. Ein paar Grimdark-Momente blitzen dabei auf, trotzdem wundert es mich, dass das Buch mancherorts als „düster“ beschrieben wird. Gut, es wird viel herumgeslasht, aber die Grundstimmung habe ich als weitgehend leichtherzig empfunden – mehr „Princess Knight“ als „Drei Engel für Armand“, auch wenn zu beiden Ähnlichkeiten bestehen.
Ein paar etwas cringy Stellen zum Trotz hatte ich insgesamt eine Menge Spaß und freue mich auf die kürzlich erschienene Fortsetzung.
Zwischenzeitlich sind zu der Truppe außerdem mehrere Kurzgeschichten erschienen, von denen ich zwei gelesen habe: Die als kostenfreies E-Book erhältliche Weihnachtsepisode „Als Prinzessin bekommt man nichts einfach so geschenkt“, die ich dann doch arg beliebig fand. Und die in der phantastisch! Nr. 92 enthaltene Episode „Warum man Prinzessinnen nicht auf den Geist gehen sollte“, eine wiederum nette Ergänzung.
„Die Prinzessinnen: Fünf gegen die Finsternis“ von Christian Endres, Cross Cult 2023, ISBN: 9-783-9866-6305-6
(3) Setting-Potenzial: „Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade und Valeria Docampo
Weiter geht’s mit etwas ganz anderem: Im Land der großen Wörterfabrik sind Wörter teuer und der junge Paul muss darauf sparen, seiner Liebsten seine Zuneigung begrifflich verständlich machen zu können. Heraus kommt mit „Die große Wörterfabrik“ ein niedliches Bilderbuch mit perfekter Ausgangslage für eine Dystopie. Es ist aber keine Dystopie. Es ist eine Liebesgeschichte über ein Pärchen, das sich mit seiner hyperkapitalistischen Umgebung arrangiert und zueinander findet. Aww. (Ja, das ist ein Kinderbuch.)
„Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade und Valeria Docampo, Mixtvision 2010, ISBN: 978-3-939435-26-6
(4) Gruselvenedig 1: „Aribella und die Feuermaske“ von Anna Hoghton
Zwecks Recherche für den TOR Online-Artikel über Fantasyromane in Venedig hatte ich mich als Erstmaßnahme in die Stadtbibliothek gesetzt und nach entsprechenden Büchern Ausschau gehalten. Zu meiner Überraschung gab es da ziemlich viel. Eigentlich wollte ich in die Titel nur reinlesen, um sie halbwegs eloquent in den Beitrag einflechten zu können, aber an einigen habe ich mich dann so festgelesen, dass ich sie zum Fertiglesen ausgeliehen und mit nach Hause genommen habe.
Das galt z. B. für „Aribella und die Feuermaske“, eine hübsch illustrierte Gruselfantasy, die sich vornehmlich an jüngere Teenager richtet. Besagte Aribella stellt im Venedig der Renaissance an ihrem 13. Geburtstag fest, dass sie zu den Cannovaci gehört, Menschen mit besonderen Fähigkeiten, denen es bestimmt ist, Venedig und den Dogen vor Unglück zu bewahren. Wie es der Zufall will, steht solches Unglück just vor der Tür, denn ein abtrünniger Bruder der Gemeinschaft will die Tore zum Totenreich einreißen und Venedig mit Geistern fluten. Da sich die Erwachsenen uneins sind, wie sie mit der Bedrohung umgehen sollen, ist es an Aribella und ihren neuen Freunden, dem finsteren Herrn das Handwerk zu legen.
Man merkt es schon an diesem Handlungsabriss: „Aribella …“ erfindet das Rad nicht neu, geübten Jugendfantasy-Lesenden dürfte nach fünfzig Seiten klar sein, worauf das Ganze hinausläuft. Trotzdem ist es eine niedliche, flott geschriebene Geschichte, und vor allem das Hotel, in dem die Cannovaci leben, bietet viel Edifice-Flair.
Allerdings: In besagtem Artikel habe ich erwähnt, dass Venedig oft nur als Kulisse dient. „Aribella …“ ist hierfür leider ein Paradebeispiel. (Spezielle) Masken und der Doge spielen zwar eine Rolle, trotzdem wirkt die Stadt selbst nur wie Staffage, und es gibt ein paar ärgerliche Ungereimtheiten (ein Palazzo direkt am Canal Grande mit mehrstöckigem Keller?!). Im Prinzip hätte man das Buch überall ansiedeln können, und vor allem – jederzeit. Dass „Aribella …“ während der Renaissance spielt, ist für die Handlung völlig irrelevant, und die Figuren verhalten sich an keiner Stelle entsprechend. Für die Zielgruppe ist das vielleicht egal, ich fand’s schade.
„Aribella und die Feuermaske“ von Anna Hoghton, dtv 2021, ISN: 9-783-4237-6350-9
(5) Gruselvenedig Nr. 2: „Das Gemälde“ von Susan Hill
Auch „Das Gemälde“ spielt (teilweise) in Venedig, ansonsten hat es mit „Aribella …“ aber nur die Gespenster gemein. Statt Jugendfantasy haben wir hier einen Mystery-Roman um ein von einem Rachegeist bewohntes Gemälde, das nacheinander drei Generationen ins Unglück reißt. Beim Lesen stellt sich schnell eine schaurige Atmosphäre ein, die jedoch nicht über die Logiklücken hinwegtäuschen kann. Bei Mystery erwarte ich zwar nicht, dass alles erklärt wird, aber ich erwarte Hinweise, aus denen man sich seinen Teil zusammenreimen kann. Abgesehen davon, dass die Identität des Geistes überraschend salopp enthüllt wird, erfährt man jedoch fast nichts über mögliche Hintergründe.
Daher hat sich bei mir mit dem Verstreichen der Seiten eine gewisse Enttäuschung eingestellt, ehe der letzte Absatz das Ruder noch mal mit einem cleveren Kniff herumgerissen hat. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Als positiv empfand ich außerdem die beklemmende Art, mit der die klaustrophobischen und weniger pittoresken Seiten Venedigs dargestellt werden. Warum der britische Rachegeist ausgerechnet in Venedig sein Unwesen treibt, erfahren wir zwar nicht, trotzdem ist die Stadt hier nicht nur Staffage.
„Das Gemälde“ von Susan Hill, Kampa 2020, ISBN: 978-3-311-27005-8
(6) Kurzweilig, aber angestaubt: „Mrs. Bradshaws höchst nützliches Handbuch …“ von Terry Pratchett
Der komplette Titel lautet „Mrs. Bradshaws höchst nützliches Handbuch für alle Strecken der Hygienischen Eisenbahn Ankh-Morpork und Sto-Ebene“. Diesen fiktionalen Reiseführer habe ich als Hörbuch in der Bahn gelesen und dafür ist es die perfekte Unterhaltung, amüsant und kurzweilig – vorausgesetzt, man kennt sich halbwegs aus in der Scheibenwelt-Fauna, denn ansonsten gehen einem einige Anspielungen verloren. In der Printversion ist wohl auch eine sicher sehr nützliche Karte enthalten. Die Witze über sexuelle Belästigung im Zug und über korpulente Verkäuferinnen hätte man aber auch 2015 schon getrost rausstreichen dürfen.
„Mrs. Bradshaws höchst nützliches Handbuch für alle Strecken der Hygienischen Eisenbahn Ankh-Morpork und Sto-Ebene“ von Terry Pratchett, Manhattan 2015, ISBN: 978-3-4425-4764-7
(7) Noch ein Magierinternat: „Magisterium 1: Der Weg ins Labyrinth“ von Cassandra Clare und Holly Black
Mit „Magisterium 1: Der Weg ins Labyrinth“ kehren wir zurück zur Kategorie „Bücher, die das Rad nicht neu erfinden“. Hier begleiten wir Call, der am Magisterium die Wege der Magie erlernen soll und gemeinsam mit seinen Freunden Aaron und Tamara in den Kampf gegen den „Feind des Todes“ hineingezogen wird.
Dass das an „Harry Potter“ bzw. beim Lesen mehr noch an „Mitternachtszirkus“ oder eine Jugendversion von Michael Peinkofers „Die Zauberer“ erinnert, finde ich nicht weiter problematisch: In dieser Hinsicht wusste ich, worauf ich mich einlasse, als ich das Hörbuch ausgewählt habe. Ab und zu ein Internat für Zauberer, Vampire oder was auch immer, geht schon in Ordnung, vor allem, wenn es von einer Kombi wie Cassandra Clare und Holly Black gestaltet wird. Dass das Buch über weite Strecken gar nicht erst versucht, originell zu sein, hat mich entsprechend ebenfalls nicht besonders gestört. Ärgerlicher fand ich den Mangel an Spannung und Detailreichtum. „Internatsbücher“ entwickeln ihren Charme durch die Mischung aus Handlung und Slice of Life. Letzteres fehlt hier aber fast völlig. Die Handlung schreitet zügig voran, was ihr insofern nicht zugutekommt, als kaum Zeit für die Figuren bleibt, sich nennenswert zu entwickeln oder Ecken und Kanten zu zeigen. Als Resultat waren sie mir weitgehend egal – und das, obwohl ich Cassandra Clare sonst so kenne, dass sie gerade hierfür ein Händchen hat. Auch der Umgang mit Calls Gehbehinderung – die immer nur erwähnt wird, wenn er wegen ihr langsamer als die anderen ist oder eine Übung nicht mitmachen kann – ist aus heutiger Sicht unglücklich.
Darüber hinaus hat mich bei diesem Buch das irrationale Verhalten der Hauptfigur sehr gestört. Sicher, es gehört irgendwo zur Jugendfantasy dazu, dass sich die Figuren ihren Mentoren widersetzen und Dummheiten begehen. Aber hier reiht sich eine solcher Aktionen an die nächste, ohne dass nachvollziehbar wäre, was zur Hölle Call sich dabei denkt. Die Schüler dürfen nachts nicht auf die Gänge? Natürlich läuft Call nachts durch die Gänge. Die Schüler sollen Abstand von Chaosbesessenen und Elementariern halten? Call hält sich heimlich Chaosbesessene und Elementarier als Haustiere. Niemand darf nach draußen, weil dort Übles lauert? Klar, dass Call draußen einen Spaziergang macht! Ebenso gibt es ein paar Stellen, die schlicht keinen Sinn ergeben. Bei einer Prüfung steht Call z. B. ständig unter Beobachtung und die Master können eingreifen, als er in Gefahr ist – mysteriöserweise bemerken sie aber nicht, dass er dabei Hilfe von einem Elementarier erhält, den er zuvor einem der Master gestohlen hat.
Der Prolog des Buchs ist klasse. Aber danach stellt sich leider schnell der Eindruck einer hastig zusammengezimmerten Auftragsarbeit ein. Gegen Ende gibt es zwar noch ein paar Wendungen, die der Reihe einen eigenen Touch geben, aber ich denke eher nicht, dass ich sie noch weiterverfolgen werde.
„Das Magisterium 1: Der Weg ins Labyrinth“ von Holly Black und Cassandra Clare, one 2015, ISBN: 978-3-8466-0004-7
*
Na das war ja ein positives Schlusswort. Trotz angemerkter Kritikpunkte sei aber erwähnt, dass sich die genannten Bücher für mich alle im mittleren bis sehr guten Bereich bewegt haben. Und für „Magisterium“ und „Aribella …“ bin ich halt eigentlich nicht mehr die Zielgruppe.
Nicht in der Auflistung enthalten sind „Die Känguru-Apokryphen“, weil ich hierzu nicht mehr zu sagen weiß als „gefiel mir gut, war wieder besser als „Die Känguru-Offenbarung“, und „The Quiet is Loud“, was ich in einem eigenen Beitrag und auf TOR Online vorgestellt hatte.
Aktuell liege ich in den letzten Seiten von „Skyward 1: Der Ruf der Sterne“. Nach einem schwerfälligen Start liest sich das inzwischen gut weg und eigentlich hätte ich es gerne hier schon vorgestellt. Aber wir wollen es mit den letzten dreißig Seiten nur wegen Jahresende nicht übereilen, das Finale will genossen werden. Meine Detailmeinung folgt daher … nun, im Juli, nehme ich an.**
Ansonsten warten hier ja noch einige angefangene Bücher, der nächste Klassiker-Reread und ein weiterer Venedig-Titel als Hörbuch für die nächsten Zugfahrten. Und dann sind da noch so einige Titel sowohl im virtuellen als auch im physischen Bücherschrank plus ein paar Titel, die mir in der Bücherei ins Auge gefallen sind … Oh, und da war doch noch dieses Rezensionsexemplar … Der Stoff wird mir so schnell nicht ausgehen.
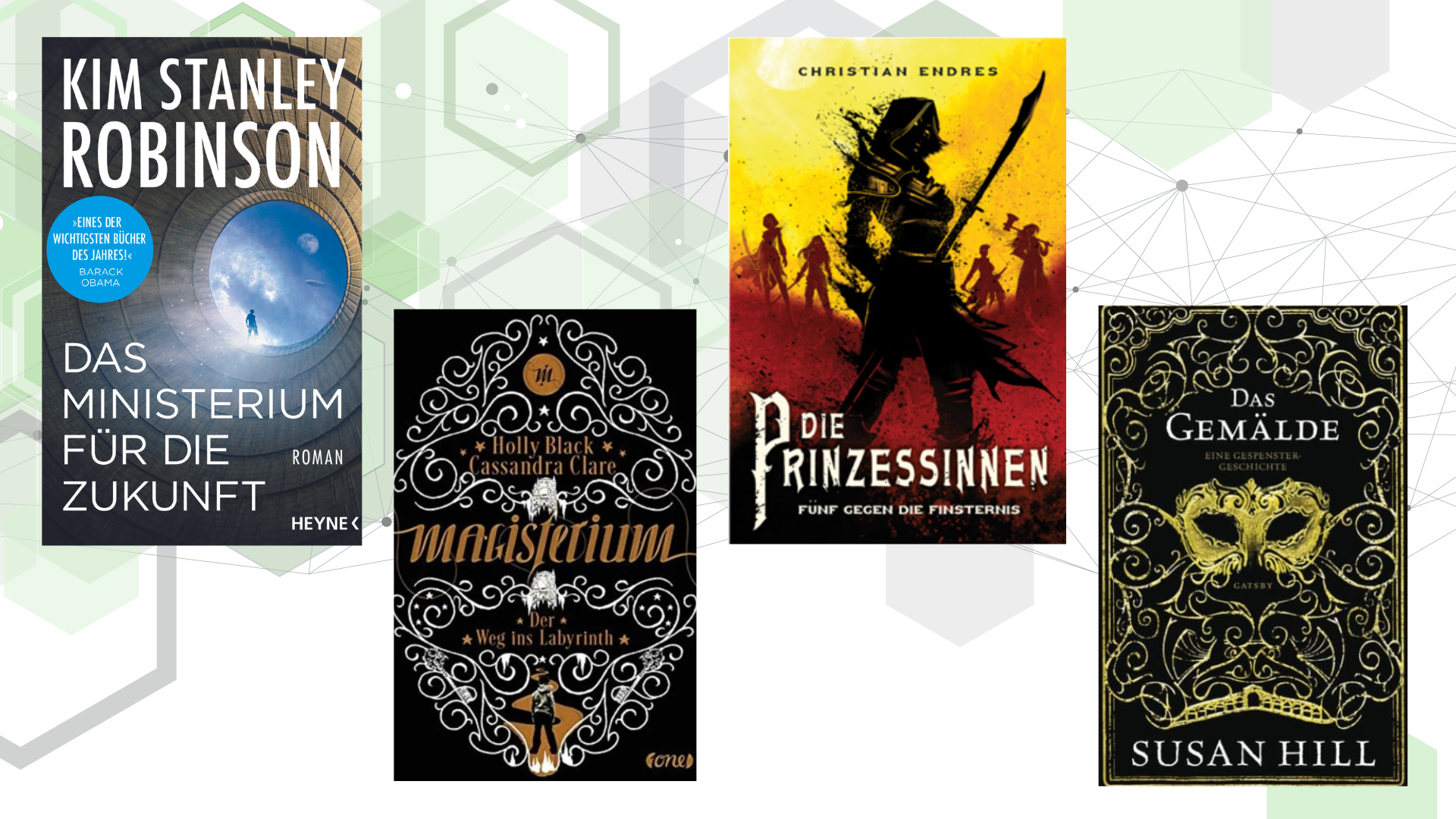
*Beim Blick auf den ohneohren-Jahresrückblick fiel mir auf, dass die Neuauflage von „Spielende Götter“ bereits Ende 2022 erschienen ist, nur Print kam erst im Januar.
**Edit vom 2. Januar: Hab das Buch tatsächlich an Neujahr ausgelesen, lol. Eigentlich wollte ich die Reihe nicht weiterverfolgen, aber jetzt war das Ende doch cliffhangerig-spannend, argh.
4 Gedanken zu „7+7 Buchansichten 2023, Teil 2“