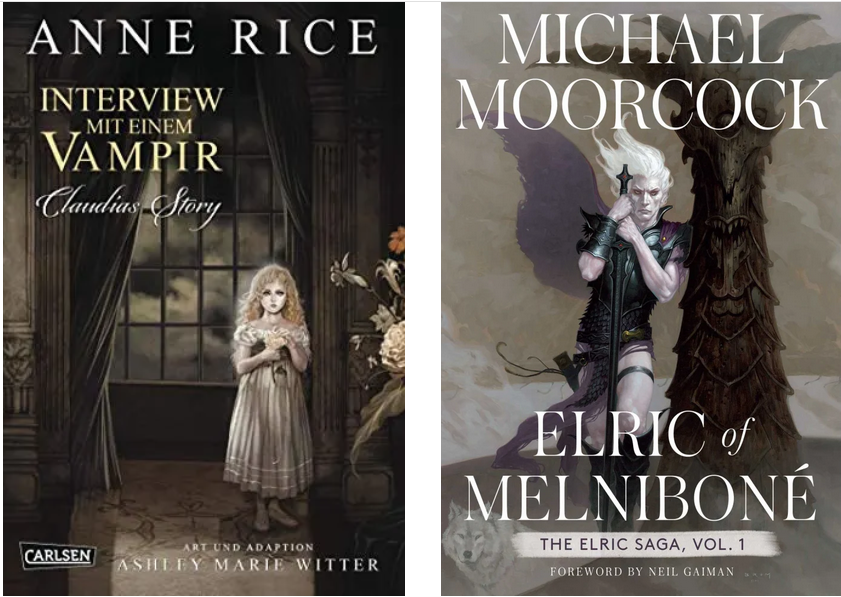
Grimdark und Dark Fantasy: Abgrenzungen
Im Diskurs verschwimmen Dark Fantasy und Grimdark Fantasy und ich wage zu prophezeien, dass Dark Fantasy (wieder) zu einem allgemeinen Sammelbegriff wird. Die Ursprünge beider Subgenres ab den 90er Jahren sind jedoch verschieden. Ein Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Das Düstere ist tot, lang lebe das Düstere: Während einerseits munter Utopien und wholesome fantasies beschworen werden, erfreut sich zugleich das Finstere großer Beliebtheit. Unwahrscheinlich, dass sich das je ändern wird, wo die Abgründe (über-)menschlicher Seelen doch so faszinierend sind! Aktuell aber scheint mir diese Liebe zum Unliebsamen noch mal neu zu erstarken. Mir begegnen täglich zahlreiche Romane, die als „Dark Fantasy“ beworben werden, und auch Games und Filme werden in Diskussionen oft entsprechend gelabelt, zuletzt etwa „Elden Ring“. Schon seit längerem hatte ich dabei den Eindruck, dass Dark und Grimdark Fantasy zunehmend gleichgesetzt werden; eine Twitter- und eine Tintenzirkel-Forumsdiskussion später fühle ich mich darin bestätigt.
Dark Fantasy als Sammelbegriff
An für sich ist das nicht verwunderlich. Zwar war Grimdark* gerade 2019 und Anfang 2020 noch mal als Gegenspieler zum Hopepunk ein Thema, das sogar überszenisch Beachtung fand. Dennoch bleibt es ein Spezialbegriff, mit dem selbst Phantastikfans meist nur vage Assoziationen verbinden. „Dark Fantasy“ ist hier weitaus sprechender, und zudem ein so allgemeiner Begriff, dass es vor allem in englischsprachigen Diskussionen naheliegend ist, wenn bloße Beschreibung („dark fantasies“) und Genrebegriff miteinander verschmelzen. Ich vermute, dass auf die Dauer die Dark Fantasy ihre momentane breite Bedeutung behalten wird. Denn letztlich entscheidet der Diskurs darüber, was wir unter einem Subgenre verstehen und die Stimmen, die Grimdark und Dark voneinander trennen, werden weniger.** Hinzu kommt, dass das Image von Grimdark in den letzten Jahren etwas gelitten hat, sein propagierter „Realismus“ wurde eher belächelt. Gut möglich, dass dadurch manche davon abgekommen sind, dieses (auch außerhalb der Phantastik verwendete) Label für ihre eigenen Werke zu nutzen.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Genrebegriffe im Laufe der Zeit eine andere als ihre ursprüngliche Bedeutung erhalten. Man denke etwa an die Urban Fantasy, die ursprünglich auf ein städtisches (Anderwelt-)Setting verwiesen hat, heute aber vor allem als Contemporary Fantasy verstanden wird. Oder an die Low Fantasy, die mal „Diesseits“-Fantasy gegenüber der anderweltlichen High Fantasy beschrieb und heute eher ein Synonym für Sword & Sorcery darstellt. Zudem wird das, was unter die „traditionelle“ Dark Fantasy der 90er und 00er Jahre gefasst wurde, inzwischen von zahlreichen Subsubgenres wie Dreadpunk, Paranormal Romance oder zuletzt auch Dark Academia bedient. Prä-90er hingegen dürfte „dark fantasy“ schon einmal eine offenere Bedeutung als in den letzten dreißig Jahren gehabt haben. So ist das mit diesen Begriffen, sie wandeln sich im Laufe ihrer Rezeption oder werden ersetzt.***
Versteht diesen Blogpost insofern bitte nicht als Pochen auf einer festen Begriffsverwendung, sondern als … historischen Abriss ab den 1990er Jahren bis zum heutigen Status Quo. Denn seither haben sich Dark und Grimdark Fantasy aus sehr verschiedenen Richtungen entwickelt, was manche Verwirrungen bzw. Missverständnisse erklärt, die in aktuellen Diskussionen aufkommen.
Sowohl auf Dark als auch auf Grimdark Fantasy bin ich bereits im Verlaufe der Genre-Reihe auf TOR Online eingegangen:
An dieser Stelle beschränke ich mich daher auf die wichtigsten Eckpunkte zu beiden Subgenres.
Dark Fantasy als Erbin des Horrors
Dark Fantasy ist ein Kind der Horrorliteratur der 1980er Jahre und entstand als Label in den 1990er Jahren. Frühe Alternativbegriffe waren „Quiet Horror“ oder „Gothic Fantasy“ und es hätte vieles vereinfacht, wäre man bei einem davon geblieben, anstatt sich für die arg allgemeine „Dark Fantasy“ zu entscheiden. Anyway. Was zeichnet sie aus, diese Variante dunkler Fantasy?
„Im Allgemeinen ist die Dark Fantasy im 19. oder 20. Jahrhundert angesiedelt und einigen der traditionellen Ikonen der phantastischen Folklore zugeneigt wie etwa dem Vampir und dem Werwolf. Es handelt sich jedoch nicht um Schockliteratur […]“
So heißt es in „Eine kurze Geschichte der Fantasy“ von Farah Mendlesohn und Edward James (Golkonda 2017, S. 179). In diesem Verständnis sind Dark-Fantasy-Geschichten solche, die in unserer Welt spielen**** und es besteht ein Miteinander zwischen Menschen und dem Übernatürlichen:
„Oft weiß man in der Dark Fantasy bereits, dass das Übernatürliche existiert, und hat sich damit arrangiert, häufig auf einem gesamtgesellschaftlichen Niveau.“
Als typische Genrebeispiele führen Mendlesohn und James u. a. Brian Stablefords David Lydyard-Romane (u. a. „The Werewolves of London“), Kim Newman („Anno Dracula / Die Vampire“) oder Freda Warringtons Blood Sequence-Reihe (u. a. „Das Blut der Liebe“) an. Für die Entwicklung zentral waren außerdem Anne Rice‘ „Gespräch mit einem Vampir“ und Chelsea Quinn Yarbros „Hotel Transylvania“. Typische deutschsprachige Vertreter*innen sind z. B. Markus Heitz mit den Pakt der Dunkelheit-Büchern oder Gesa Schwartz, u. a. mit Grim.
Heute weist das Subgenre oft starke Parallelen zu Paranormal Romance und Krimi-Fantasy auf – womit wir zugleich bei der Urban Fantasy wären. Typische Themen sind Vergänglichkeit und Unsterblichkeit (oft entsprechend repräsentiert durch Vampire, Engel usw.), Wahn und dunkle Leidenschaften. Auch die Beschäftigung mit Okkultem spielt eine Rolle, und Symbolen und Metaphern kommt eine große Bedeutung zu. Die Grundstimmung ist melancholisch, ästhetisch besteht eine Verwandtschaft zur Gothic- und Dark-Wave-Kultur, inhaltlich auch zur Schauerromantik.
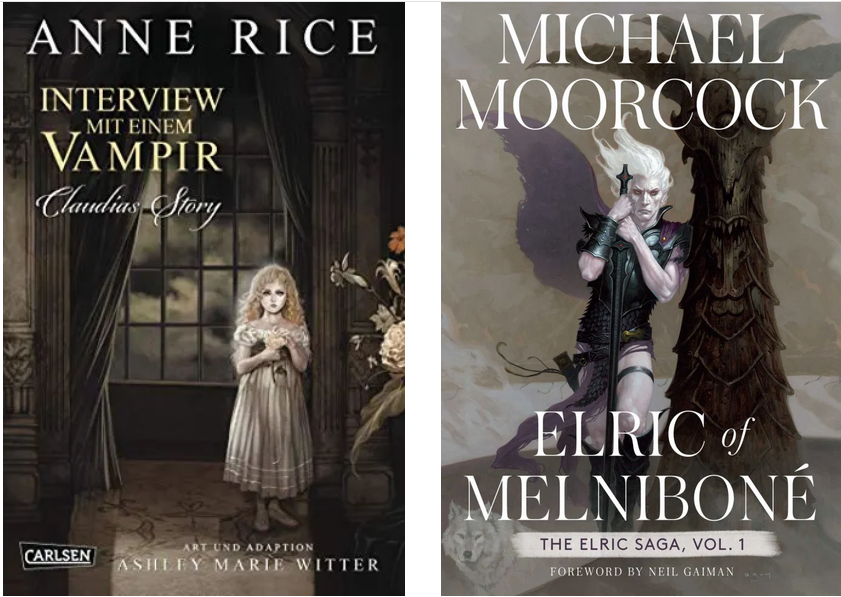
Grimdark als Erbe der Sword & Sorcery
Grimdark hingegen entstammt einer düsteren Spielart der Sword & Sorcery, einer ihrer frühen „Helden“ ist Moorcocks Elric von Melniboné. Noch prägender für ihr heutiges, dreckiges, teils von Hoffnungslosigkeit, Grausamkeit und Nihilismus geprägtes Image sind allerdings Glen Cooks Die Schwarze Schar oder Joe Abercrombies jüngere Kriegsklingen-Saga. Das wohl populärste, obwohl im Vergleich noch softe Beispiel ist zudem George R. R. Martins Das Lied von Eis und Feuer. Ein deutschsprachiges Beispiel ist Elea Brandts „Opfermond“.
„Grimdark texts typically feature morally dubious or ambiguous characters, unheroic protagonists, and ambivalent outcomes. Like quest fantasy, grimdark evokes enchantment through the creation of an absorbing fictional world and struggling protagonists, but it rejects or problematises the affirmative feelings typically evoked by fantasy texts. In grimdark quests may not be completed, good may not triumph, and characters are vulnerable to illness, injury and death. Whereas quest fantasy is usually optimistic, grimdark fantasy is pessimistic and sometimes nihilistic.“
So fasst Ria Cheyne den Grimdark in „Disability, Literature, Genre“ zusammen (Liverpool University Press 2019, S. 124). Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass im Grimdark explizite Beschreibungen keine Seltenheit sind. Interessant für die Bewertung des Einflusses auf Genrediskussionen wäre auch, ab wann der Begriff eigentlich verwendet wurde, allerdings habe ich hierzu keine eindeutige Antwort gefunden. Zwar entstammt die Bezeichnung einem Zitat aus Warhammer 40k, was 1987 auf den Markt kam, aber ich vermute, dass einige Zeit verstrichen ist, bis sich daraus tatsächlich Grimdark entwickelt hat. Richtig populär wurde er jedenfalls erst dank Serien wie Game of Thrones, Walking Dead oder Breaking Bad. Entsprechend ist die Vermutung naheliegend, dass vieles, was ab den 2010er Jahren unter Grimdark lief, früher schon mal als (bedeutungsoffenere) Dark Fantasy gelabelt wurde.
Dark vs. Grimdark Fantasy
Dennoch, auf den ersten Blick scheinen die Unterschiede deutlich: Horror vs. Sword & Sorcery oder Questen Fantasy. Unsere Welt vs. fiktive Welt. Vampire und Werwölfe vs. … was auch immer einem in Fantasywelten so begegnen kann. Oder auch nicht begegnen kann, denn nicht selten sind im Grimdark die Menschen eher mit sich selbst beschäftigt.
Ganz so einfach ist es allerdings doch nicht. Ich behaupte, dass beide Spielarten weniger von harten Faktoren wie dem Setting oder der Orientierung an einer bestimmten zeitlichen Epoche leben, sondern mehr von ihrer Atmosphäre und einigen Kernelementen. Wo Dark Fantasy melancholisch ist, ist Grimdark nihilistisch. Wo Dark Fantasy das Mystische feiert, widmet sich Grimdark „realistischeren“ Abgründen. Wo Dark Fantasy den Tod als schwierigen Freund betrachtet, ist er im Grimdark der unausweichliche Feind. Wo Dark Fantasy aus Sicht von Monstern erzählt, ist Grimdark das Monster.
Diese Sichtweise macht beide zu Ästhetiken, die sich munter auf andere Subgenres anwenden lassen. Ich nenne z. B. gerne die Dark Disciple-Trilogie aus der Drachenlanze-Saga als Beispiel, wie Dark-Fantasy-Elemente (Beschäftigung mit Unsterblichkeit, dunkle Romanzen, Bekämpfung innerer Dämonen) in der High Fantasy eingesetzt werden.
Dark feat. Grimdark Fantasy
Diese flexible Anwendbarkeit sorgt aber eben dafür, dass es ebenso Werke gibt, dich sich sowohl als Dark Fantasy als auch als Grimdark Fantasy interpretieren lassen. Ein Artikel von Atmostfear Entertainment spricht sich etwa dafür aus, Tanith Lees klassischerweise als Dark Fantasy eingeordnete Romane als Grimdark zu betrachten. Schwierig wird es zudem, wo Völker ins Zentrum gerückt werden, die moralisch ganz schön grau sind, vom Ästhetikverständnis her aber prima in die Vampirgesellschaften der Dark Fantasy passen würden (z. B. Heitz‘ Albae oder die Drow). Gritty Dark Fantasy ist insofern ein Ding.
Besonders interessant finde ich darüber hinaus den Blick in die Jugendfantasy, die inzwischen so einige düstere Ausflüge und Genre-Crossover zu bieten hat. Mit ihrem Vampir- und Unsterblichkeits-Topic und der viel besprochenen Melancholie ordne ich die Twilight-Saga klar der Dark Fantasy zu, für deren Entwicklung in den letzten 15 Jahren sie zudem sehr zentral war – wenngleich das manchen ein Dorn im Auge sein mag. Grimdark-Elemente sehe ich hier hingegen (aus der Sekundärliteratur heraus) keine.
Anders sieht es mit Jay Kristoffs Nevernight-Trilogie, Melissa Marrs „Shadow World: Krieg der Seelen„, oder Darran Shans Dämonicon-Saga aus. Alle drei haben sowohl Dark- als auch Grimdark-Elemente und gehen nicht gerade zimperlich mit ihren Figuren um. Müsste ich mich entscheiden, würde ich Nevernight und Shadow World eher dem Grimdark zurechnen, Dämonicon hingegen der Dark Fantasy oder sogar dem Splatter. Eine Rolle spielen bei dieser Einordnung die explizitere Erotik in Nevernight und Shadow World, die eher dystopischen Gesellschaftsdarstellungen und dass beides in fiktiven Fantasywelten spielt (oder diese, im Falle von Shadow World, wichtiger ist). Zentralster Punkt aber ist für mich, dass sich die Gewalt im Dämonicon unpersönlicher anfühlt. Die Menschen werden in der Regel nicht aus irgendwelchen Machtansprüchen heraus getötet, sondern weil es im Wesen der Dämonen liegt. Inwiefern dieses von ihnen selbst hinterfragt wird, führt dann wiederum zur Frage, ob wir es eher mit Dark Fantasy oder Horror zu tun haben, aber das Fass machen wir jetzt mal lieber nicht im Detail auf.
Einen weiterer schwieriger Fall, bei dem ich mich nicht recht entscheiden kann, ist Broms „Der Kinderdieb“. Von der Atmosphäre her würde ich klar von Dark Fantasy reden, aber einige Sequenzen waren so grim, dass ich das Buch, obwohl ich es sehr mochte, eher kein zweites Mal lesen möchte.
Um alles, was ich bisher geschrieben habe, noch mal in Frage zu stellen, sei zudem noch erwähnt, dass sowohl für Dark als auch für Grimdark Fantasy angeführt wird, dass beide nicht in der Eukatastrophe enden (müssen). Den Strukturalisten unter den Genre-Theoretiker*innen scheint mir dieser Punkt sehr wichtig zu sein, und er führt wiederum dazu, dass beide Subgenres miteinander verschwimmen. Manch traditionellere Quelle wie die Encyclopedia of Fantasy ignoriert Grimdark, was wie gesagt erst im 21. Jahrhundert eine breitere Diskussion erfahren hat, daher komplett.
So hängt es letztlich häufig von der Interpretation der Lesenden, von deren Fokus und sogar deren „Genre-Schule“, ab, ob ein Werk nun eher Grimdark oder Dark Fantasy ist. Entsprechend ist es wohl kein Wunder, dass die Unterscheidung langsam (wieder) schwindet bzw. neuen Begriffen Platz macht.
*Übrigens verwende ich Grimdark wiederum synonym zu Grim and Gritty.
**In einer überhaupt lesenswerten Rückschau auf Grimdark geht auch Swantje Niemann kurz auf die Unterschiede zur Dark Fantasy ein.
***Eine Zusammenfassung verschiedener im Netz zusammengekommener Beschreibungen zur Dark Fantasy findet ihr auf dem Blog von Christian Milkus. Er zitiert dabei auch aus der eingangs erwähnten Tintenzirkel-Diskussion.
****An diesem Punkt wirkt zumindest die deutschsprachige Version des Buches etwas widersprüchlich, weil Dark Fantasy als „immersive Fantasy“ vorgestellt und der Begriff so erklärt wird, als befände sich „der Leser in einer gänzlich anderen Welt“. Ein Essay von Mendlesohn später bin ich aber der Ansicht, dass diese „gänzlich andere Welt“ nicht als Anderwelt im engeren Sinne verstanden werden soll. Es geht wiederum mehr darum, dass die übernatürlichen Regeln die gesellschaftliche Norm darstellen. Aber das nur als Exkurs am Rande, vielleicht gehe ich darauf noch mal an anderer Stelle ein. (Bis dahin siehe „Towards A Taxonomy of Fantasy“ von Farah Mendlesohn in Journal of the Fantastic of the Arts, Vol. 13, Nr. 2, 2022, S. 169-183).
Text unter CC BY (= Verwendung ok, aber Name und Quelle nennen!)
9 Gedanken zu „Grimdark und Dark Fantasy: Abgrenzungen“