
[Gastartikel] Facettenreiche Fledermaus
[Wer mit mir chattet und dabei viel Know-how über ein interessantes Thema zeigt, läuft Gefahr, von mir zu einem Gastbeitrag eingeladen zu werden. 2017 kam es so z. B. dazu, dass Fabienne Siegmund über literarische Teddybären schrieb. Und aufgrund eines erhellenden Gesprächs über Comics und Comicverfilmungen, in dessen Zuge Autorenkollege Tino Falke mir verriet, dass er seine Masterarbeit über ein Batman-Thema verfasst hatte, kam es zu dem nun nachfolgenden, comic- und filmhistorischen Beitrag über das wechselhafte Wesen des Fledermausmanns. Und das auch noch passend zum diese Woche anstehenden Release von „The Batman“! Vielen Dank, Tino, dass du meiner Einladung zu einem Gastartikel gefolgt bist, und euch anderen – enjoy.]
***
Batman – gemarterter Einzelgänger mit ewigem Trauma und Aggressionsproblemen? Oder liebevolle Vaterfigur mit Wortspielen auf den Lippen und randvollem Freundschaftsalbum?
Why not both? Ein Überblick über die vielen Seiten des Mannes im Fledermauskostüm, von den ersten Comics bis zum neuesten Film.
Am 3. März 2022 ist es so weit – Batman kehrt ins Kino zurück. Die Trailer für Matt Reeves’ Verfilmung mit Robert Pattinson nehmen das „Dark“ im Dark Knight einmal mehr sehr wörtlich. Die Farbpalette ist düster, die Stimmung angespannt, die Gewalt ungeschönt brutal, und comichafte Schurk*innen, die Pflanzen oder Eis kontrollieren und dabei alberne Witze reißen, sucht man vergebens. Für manche genau der knallharte, gritty Ansatz, den sie sich vom gebeutelten Helden im Fledermauskostüm wünschen, für andere ermüdend nach mehreren ähnlich düsteren Darstellungen auf der Leinwand. Ein Batman ohne Farbe und Freude – muss das so?
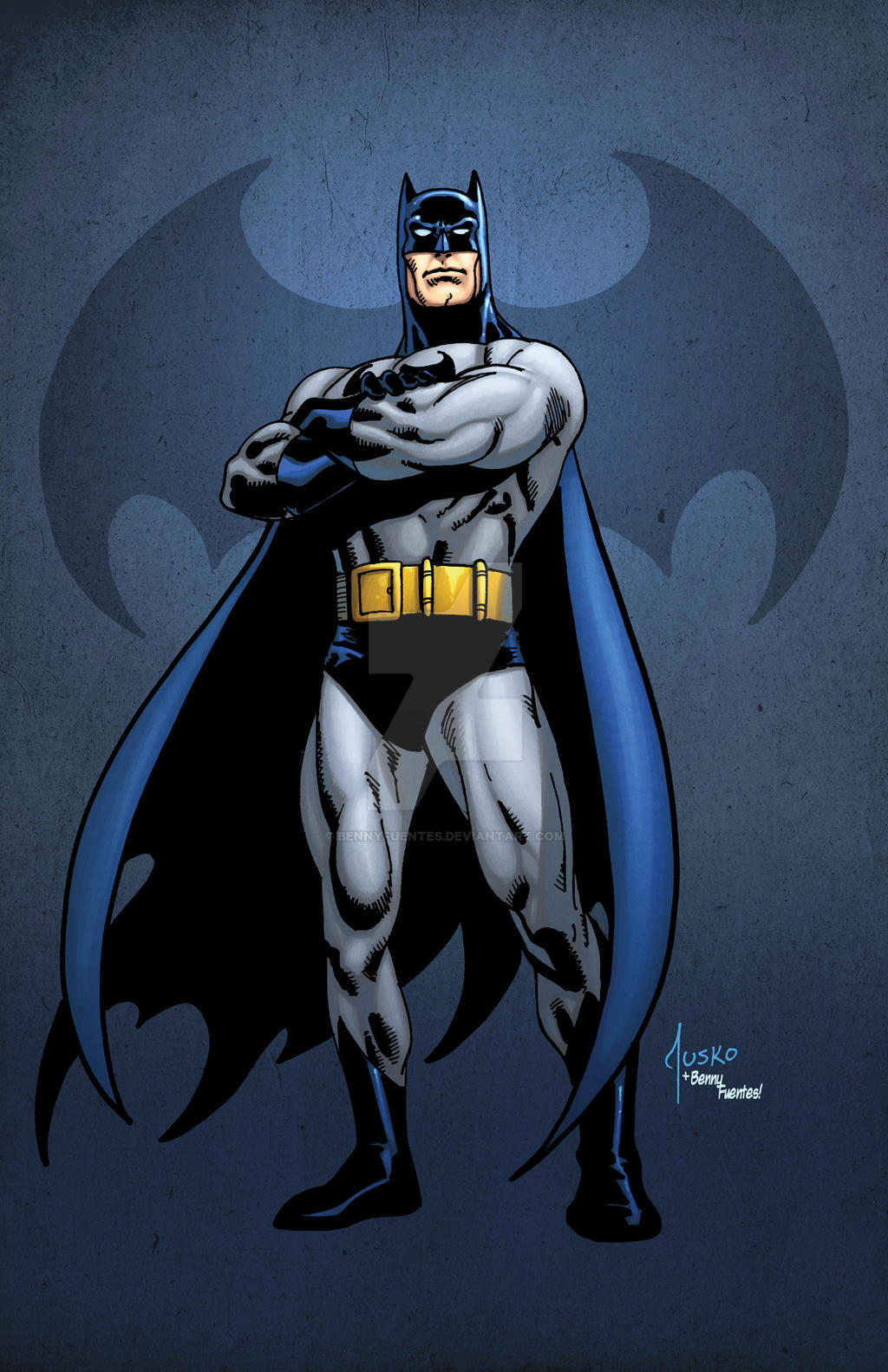
Der Name ist Bat-Man. The Bat-Man.
Ein Blick zurück in seine Vergangenheit zeigt, dass die Stimmung der Batman-Comics und ihrer Adaptionen immer Schwankungen unterlegen war. Seinen ersten Auftritt hatte Batman in der Geschichte „The Case of the Chemical Syndicate“ in Detective Comics #27 (Mai 1939), geschrieben von Bill Finger und gezeichnet von Bob Kane. Damals noch „the Bat-Man“ genannt, präsentiert er bereits viele Attribute, mit denen die Figur bis heute assoziiert wird: Er hat keine Superkräfte, sondern nutzt Kampfkunst und Detektivfähigkeiten. Er agiert außerhalb des Gesetzes und allein, kämpft aber gegen Ungerechtigkeit. Seine Identität ist dabei geheim, nach außen ist er als desinteressierter reicher Playboy Bruce Wayne bekannt. Der Tod seiner Eltern bei einem Raubüberfall, nach dem er schwört, alles Verbrechen bekämpfen zu wollen, wird vier Monate später Teil von Batmans Hintergrund. Gelacht wird wenig in Gotham City.
In Detective Comics #38, der letzten Ausgabe, bevor im Frühjahr 1940 die Solo-Reihe Batman begann, wurde erstmals der junge Mitstreiter Robin eingeführt – was die Verkaufszahlen schlagartig verdoppelte. Der von Pulphelden wie Zorro, Dick Tracy und Scarlet Pimpernel inspirierte Einzelgänger im schwarz-grauen Anzug wurde damit schon im ersten Jahr seiner Publikationsgeschichte Vaterfigur für einen armen Waisenjungen. Der Ton der Geschichten wurde fröhlicher, Robins rot-grün-gelbes Kostüm sorgte für mehr Farbe und die beiden scherzten ausgelassen, während sie mit viel Akrobatik Gangster vermöbelten.
Anfangs schreckt Batman nicht davor zurück, zu töten, sogar Feinde im Schlaf zu erschießen. Ein 1940 in den USA geführter Diskurs über angebliche Gefahren von Comics für die Jugend, u.a. wegen sexueller und gewaltverherrlichender Inhalte, sorgte jedoch für einen neuen Moralkodex Batmans. Plötzlich hält er sich an die Regel, niemanden zu töten und keine Waffen zu benutzen. 1941 wird er zudem Ehrenmitglied der Polizei, und seine düstere Maske wird schmaler, damit man Bruce Waynes charmantes kantiges Kinn besser sehen kann.
Zwei Jahre nach Entstehung ist der Caped Crusader also bereits weicher, netter, umgänglicher – in den Comics des Golden Age wird sogar regelmäßig die vierte Wand durchbrochen, um pädagogische Appelle an die Leserschaft zu richten. Moralapostel Batman fordert mehr Freizeitangebote für die Jugend, unterstützenden Familienzusammenhalt und eine klare Positionierung gegen jede Art von Verbrechen. Auch während des Zweiten Weltkriegs bleibt er volksnah und kümmert sich vor allem weiter um Straßenkriminalität. Patriotische Botschaften wie bei den Kollegen Captain America und Major Victory (beide 1941) sind bei Batman selten. Potenziell internationale Konflikte beschäftigen ihn nur, wenn sie ihn persönlich, seine bereits etablierten Feind*innen oder Gotham City betreffen.
Vom Dark Knight zum Campy Crusader (und wieder zurück)
Zwei Schwarz-Weiß-Serien in den 40ern brachten Batman erstmals auf die Leinwand, hinterließen aber wenig Eindruck in der Filmlandschaft – zwar nutzt er fortschrittliche Technologie und detektivische Fähigkeiten, doch beeindruckendes Kampfgeschick und ikonische Gegenspieler*innen sucht man vergebens. Auch die Verkaufszahlen der Hefte sanken, nachdem 1954 ein „Comics Code“ eingeführt wurde, der zwar u.a. für mehr Frauenfiguren wie Batgirl und Batwoman, doch ansonsten für einen zu gemütlichen, fast langweilig zahmen Batman sorgte. Ende der 50er nahm zudem der Science-Fiction-Aspekt der Geschichten zu. Doch erst die von Pop-Art und Camp[1] inspirierte, knallbunte Serie Batman von William Dozier (ab 1966) löste wieder Begeisterung aus.
Die Serie ließ Batman und Robin mit überspieltem Ernst die absurdesten Abenteuer erleben[2] und beeinflusste damit wiederum die Comics, in denen u. a. Robins Ausruf „Holy!“ übernommen, Batgirl eingeführt und das Auftreten von Butler Alfred überarbeitet wurde. Sie entfernten sich zudem weiter von den Noir- und Pulp-Wurzeln. Statt Detektivgeschichten mit Kleinkriminellen gab es Fantasy- und Science-Fiction-Abenteuer, in denen schon mal Kreaturen aus anderen Dimensionen oder Aliens bekämpft werden, durch die Zeit gereist oder Batman in ein Baby verwandelt wird. Nach der heiteren Phase (und dem Ende der Serie 1968) sanken die Verkaufszahlen abermals, und graduell wurde versucht, zu Batmans dunklen Wurzeln zurückzukehren. Dick Grayson, der erste Robin, geht studieren, Batman arbeitet wieder allein und verlässt sogar den Held*innen-Verein Justice League, den er mit Superman und Wonder Woman gegründet hat.
Der große Umschwung und das Ende von Batmans Silver Age kamen jedoch erst 1985 mit dem 12-teiligen Event „Crisis on Infinite Earths“. Nach realitätsbeeinflussenden Ereignissen in der Reihe, die das gesamte DC-Comic-Universum betrafen, sollte ein neuer Kanon etabliert werden, viele frühere Geschichten haben also offiziell nie stattgefunden. Für Batman bedeutete dies eine Ausrichtung hin bzw. zurück zu bodenständigeren, ernsteren Fällen. Als Ausgangspunkt galt „Year One“ von Frank Miller und David Mazzucchelli (1987). Dass Miller die düstere Herangehensweise begrüßt, ist keine Überraschung für alle, die z. B. „Sin City“ oder „300“ gelesen (oder gesehen) haben. Der kontroverse Autor ignorierte einfach viele Jahrzehnte von Batmans Entwicklung und erklärte im Nachwort: „For me, Batman was never funny.“
Nichts zu lachen in der Batcave
In „Year One“ macht sich eine Hoffnungslosigkeit breit, die Batman bis heute verfolgt. Die Polizei ist fast durchweg korrupt, es herrschen willkürliche Polizeigewalt, Bestechung und Lobbyismus – nur Commissioner Jim Gordon bleibt (wie ab dem allerersten Comic) ein „guter“ Verbündeter. Statt schillernder Larger-than-Life-Gestalten sieht sich Batman wieder mit Kleinkriminellen und organisiertem Verbrechen bis hinauf in Mafia-Ränge konfrontiert. Der Mord an seinen Eltern, dem er als Kind zusehen musste, wird deutlich ins Spotlight gerückt. Statt Wortspielen oder auch nur einem Lächeln gibt es Angst und Trauer. Bruce Wayne hat seinen Verlust nie überwunden, und vielleicht hilft das Verprügeln von Verbrecher*innen doch nicht so gut wie professionelle Traumatherapie. Mit dem Fokus auf seine gebeutelte Psyche wird trotz aller Trostlosigkeit ein spannendes neues Kapitel für Batman eröffnet und macht klar: Jemand, der tut, was Bruce Wayne tut, kann weder strahlender Held noch Vorbild sein.
Die Comics dieser Zeit sparten nicht an weiteren einschneidenden Ereignissen. In „Death in the Family“ (1988) stirbt Jason Todd, der zweite Robin, nachdem Fans per Anruf über sein Schicksal abstimmen durften (und das Ergebnis mit 5271 zu 5343 Stimmen denkbar knapp ausfiel). In „The Killing Joke“ (1988) wird Gordons Tochter Barbara angeschossen und ist danach hüftabwärts gelähmt. In der „Knightfall“-Reihe (1993–1995) bricht Mastermind und Muskelpaket Bane Batmans Rücken und setzt ihn damit monatelang außer Gefecht. Spätestens jetzt war er ein gebrochener Held.
Die Verfilmungen „Batman“ (1989) und „Batman Returns“ (1992) von Tim Burton betonten weiter Waynes Zerrissenheit und sein Trauma. Gegenspieler*innen wie der Pinguin und Catwoman wurden ihm als Spiegel vorgehalten, da es sich genauso um sozial Ausgestoßene mit gespaltenen Persönlichkeiten handelte (nicht im medizinischen Sinne, aber ausgedrückt durch Tarnidentitäten und Maskierungen). Inwieweit ein weißer Milliardär in einer US-Großstadt als Ausgestoßener gelten kann, ist sicher fraglich, doch als in sich gekehrter Exzentriker wird Wayne in Burtons Filmen trotz des Reichtums und des getreuen Butlers als einsam und sozial ungelenk dargestellt. Bob Kane selbst begrüßte die Rückkehr zur grimmigen „Kreatur der Nacht“ mit mehr Pathos als Comedy.
Das Thema „Freak unter Freaks“ wurde auch in den Comics aufgegriffen. Im großartigen Noir-Krimi „The Long Halloween“ von Jeph Loeb und Tim Sale (1996–97), der inhaltlich an „Year One“ anschließt, werden die realistischen Gangster und Mafiosi nach und nach von den bekannten, phantastischen Superschurk*innen wie Joker, Scarecrow, Poison Ivy und Mr. Freeze verdrängt. Staranwalt Harvey Dent wird zudem zu Two-Face, und Batman muss sich neben oldschool Detektivarbeit mit der Frage befassen, ob seine Anwesenheit nicht mit dafür sorgt, dass sich eine buntere, exzentrischere Art von Kriminalität in Gotham City ausbreitet. Auch in „Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth“ (1989) von Grant Morrison und Dave McKean wird diese Frage behandelt und Batmans Nähe zu denen, die er eigentlich bekämpfen will, sogar in seinen eigenen Gedankenmonologen verdeutlicht.
Holy Stimmungsschwankungen, Batman!
Spätestens mit den Filmen „Batman Forever“ (1995) und „Batman & Robin“ (1997) war es mit diesen ernsthaften Betrachtungen jedoch vorbei. Regisseur Joel Schumacher widmete sich kurz Waynes Trauma, doch verschrieb sich ansonsten wieder ganz dem Camp – die Filme nahmen sich nicht ernst, alles war knalliger und extravaganter als nötig, Gotham ist voller riesiger Statuen, alberne Wortspiele fanden zurück in die Dialoge, die Kostüme waren übertrieben sexualisiert, und alles wurde danach designt, als Spielzeug vermarktbar („toyetic“) zu sein. George Clooney, der den nicht mehr so Dunklen Ritter 1997 verkörperte, hielt auch vom Festhalten an Waynes Trauma nichts: „I don’t think anybody is gonna feel sorry for and listen to a guy going: Woe is me. My parents died when I was 4.“ Nach schlechten Kritiken wurde eine geplante Fortsetzung nicht mehr realisiert, und heute haben die Filme eher Trash-Kult-Status. In Hinblick auf die Vorlage lassen sie sich als Adaption der Comics der 60er und 70er deuten: Sie zeigen vielleicht nicht den Batman, den das moderne Publikum will, doch werden durch ihn Jahrzehnte seiner Comicgeschichte aufgegriffen.
Gemäß der beschriebenen Schwankung musste die nächste Adaption wieder düster und ernst sein – die Trilogie von Christopher Nolan („Batman Begins“, „The Dark Knight“, „The Dark Knight Rises“, 2005–2012) nutzte deshalb Elemente aus „Year One“, um einen möglichst realistischen Batman fern von übernatürlichen Elementen zu zeigen. Auch seine Ausrüstung (inkl. des Batmobils), die hier vorwiegend zu Militärzwecken entwickelt wurde, wird erstmals in der Filmgeschichte ausführlich erklärt. Der Mann hinter der Maske ist erneut von Ängsten und Verlustverarbeitung gezeichnet, er ist verwundbar und zuweilen körperlich unterlegen, wenn er nicht auf hochmoderne Gadgets zurückgreifen oder aus den Schatten heraus agieren kann. Im Mittelteil der Trilogie greift Batman zu drastischen Maßnahmen wie illegaler Auslieferung, erweiterten Verhörtechniken und Geheimüberwachung einer ganzen Stadt, um den Terroristen Joker zu stoppen – ob diese Mittel glorifiziert oder kritisiert werden, liegt wohl im Auge des Publikums. Teile der echten Welt jenseits von Comics sind sie spätestens seit dem Krieg gegen den Terror nach 9/11.


Als nächste Reaktion in die leichtherzigere Richtung kann „The Lego Batman Movie“ (2014) gesehen werden, der sich frei am Kanon bedient, auf fast alle vorangegangenen Adaptionen anspielt und Bruce Waynes Trauer um seine Familie zu Bindungsängsten erweitert, die er konfrontieren muss, als Robin in sein Leben tritt und sich eine Found Family entwickelt. Der animierte Film zeichnet sich durch viel Humor statt Dunkelheit aus. Batmans Status als Waisenkind ist eher Punchline für Gags, selbst seine erbitterte Feindschaft mit dem Joker wird in eine von beiden gewünschte Hassliebe umgedeutet, die sich allerdings auch aus moderneren Comics lesen lässt. Die Entwicklung weg vom Einzelgänger hat in den Comics (trotz eines weiteren Gesamt-Reboots 2011, nach dem Batman vorerst wieder allein unterwegs war) dazu geführt, dass sich eine „Bat Family“ gebildet hat, grob bestehend aus allen, die je als Robin oder Batgirl mitgekämpft haben, sowie anderen Verbündeten. Solo-Abenteuer sind eine Seltenheit geworden. Zwischenzeitlich sind Batman und Catwoman sogar ein Paar geworden, und Bruce Wayne wurde Vater.
In „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und „Justice League“ (2017) ist der Grundton wieder düster, die Farben entsättigt, Spaß wird klein geschrieben, Bombast dafür groß. Es handelt sich um die ersten Batman-Filme, seitdem DC in Antwort auf das Marvel Cinematic Universe (MCU) versucht, eine eigene zusammenhängende Kinoreihe seiner Held*innen zu etablieren. Während das MCU sich oft darauf konzentriert, die Reihe um Iron Man, Captain America, Black Widow & andere Avengers durch lockere Stimmung und viel Spaß popcornkinotauglich zu machen, konzentriert man sich bei DC auf eine „dark and gritty“ Ästhetik, vielleicht als Kontrast zur Konkurrenz, vielleicht um mehr Erwachsene in die Kinosessel zu locken. Die letzte Interpretation Batmans durch Ben Affleck hat loyale Fans, vor allem unter denen, die den Stil des Regisseurs Zack Snyder schätzen – hier wird aber wieder mit gepanzerter Ausrüstung, Waffengewalt, viel Wut und wenig Nuancen ein grimmiger, polternder Actionheld dargestellt, wo ein cleverer Detektiv sein könnte. Auch dafür gibt es natürlich Präzedenzfälle in den Comics, hinter dem Potenzial Batmans bleibt die Darstellung jedoch zurück.
Quo vadis, Pattinson?
Ohne drollig-bunte Neuinterpretation zum Durchatmen und Lachen zwischendurch folgt nun die nächste Adaption, die das düstere, realistische, gewaltvolle Rad neu erfinden will – der Titel „The Batman“ verweist deutlich auf die allerersten Comics. Pattinson hat bereits in Interviews verkündet, dass sein Bruce Wayne noch am Beginn der Helden-Laufbahn steht, es ihm an Selbstbeherrschung mangelt und er seinen Zorn in seiner eigenen Art brutaler Gerechtigkeit auslebt. Trailer und das rot-schwarze Promo-Material versprechen einen Riddler als Serienmörder à la „Zodiac“ oder „Sieben“, einen Gangsterboss-Pinguin, soziale Isolation des jungen Wayne und viel Korruption auf Seiten der Polizei. Es bleibt also dunkel in Gotham City.
Der Blick zurück bis 1939 zeigt, dass viel davon abhängt, wie das Publikum die Batman-Adaptionen aufnimmt. Sinkende Verkaufszahlen der Comics und schlechte Kritiken der Filme hatten stets einen Umschwung zur Folge. Nachdem die bunte Batmania der 60er abgeklungen war, wurde es ernster, nach Burtons Charakterstudien im Kino wieder schriller und lauter mit Schumacher, danach wieder versucht realistisch etc.
Pattinsons offenbar zorniger, unhinged Batman ist keine Überraschung, aber sein Erfolg wird entscheiden, ob das DC Extended Universe im Kino die Stoßrichtung beibehält (wie bei „Joker“) oder sich mehr am lockeren MCU orientiert (wie es bei „Aquaman“ und „Shazam“ versucht wurde). Dass eine ikonische Figur wie Batman viele verschiedene Facetten zulässt, von denen keine ganz out of character ist, sollte in Hinblick auf über 80 Jahre Geschichte in Comics und Leinwandadaptionen deutlich geworden sein. Ob Pattinsons Version eine versöhnliche Wende nimmt oder sich in der Finsternis um ihn herum verlieren wird, kann erst gesagt werden, wenn der Abspann läuft. Egal ob der Film später gut ankommt oder nicht, ob man mehr Grittiness oder etwas mehr Leichtigkeit bevorzugt – mit dem Batman, wie man selbst ihn am liebsten hat, liegen jede Menge Comics bereit.
Lesetipps:
- Andrae, Tom/Kane, Bob: „Batman and Me“, 1989
- Brooker, Will: „Batman Unmasked. Analysing a Cultural Icon“, 2000
- Brooker, Will: „Hunting the Dark Knight. Twenty-First Century Batman“, 2012
- Collinson, Gary: „Holy Franchise Batman! Bringing the Caped Crusader to the Screen“, 2012
- Kistler, Alan via Polygon.com: „Why Batman stopped killing People in 1940„, 2019
- Hooton, Chrstopher via Independent.co.uk: „DC finally admits it’s been trying to make films too gritty and dark„, 2016
[1] Camp als Kunstrichtung zeichnet sich durch absichtliche Übertreibung bis fast zum Kitsch aus, Susan Sontag definierte es 1964 in ihrem Werk „Notes on Camp“ als „artifice, frivolity, naïve middle-class pretentiousness, and shocking excess“, also betont künstlich, verspielt, unbeschwert und theatralisch.
[2] Im Film zu William Doziers Serie werden z. B. die Mitglieder der United-Worlds-Versammlung erst zu Pulver dehydriert, dann durch Wasserzufuhr wiederbelebt.
Disclaimer: Die vielen Adaptionen als Trickfilm (z.B. die unter Fans hochgelobte Serie „Batman: The Animated Series“) und die verschiedenen Videospiele (wie die aktuellste „Arkham“-Reihe) werden aus Platzgründen nicht in diesem Artikel behandelt.
Der Text steht unter CC BY ND (BY: Tino Falke via Fragmentansichten.com)

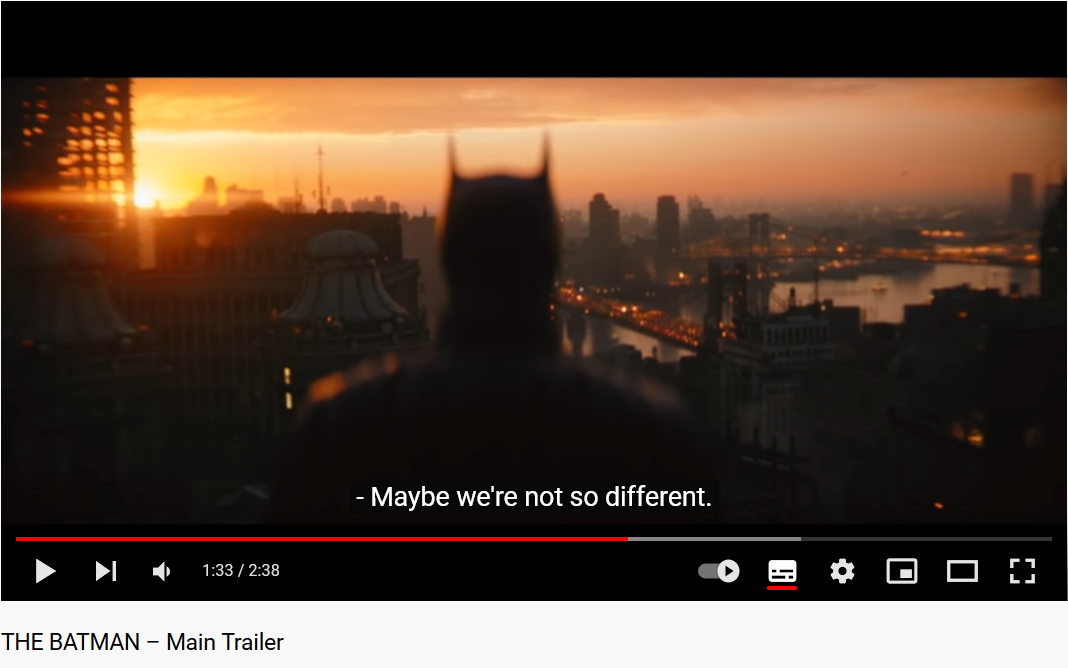
2 Gedanken zu „[Gastartikel] Facettenreiche Fledermaus“