
Katastrophen-Sternstunde
Über Mary Robinette Kowals „Die Berechnung der Sterne“ und (andere) Apokalypse-Medien
Eine Apokalypse, die ist vielfältig: Vage Gedanken über Katastrophenfilme mit superkompetenten Dudes und über Mary Robinette Kowals Alternate-History-Roman „Die Berechnung der Sterne“ als Kontrastprogramm. Achtung – Spoiler ahead!
Als Kind war ich fasziniert von Katastrophen.
Nein, ganz so voyeuristisch wie es klingt, war es zum Glück nicht. Harmloser ausgedrückt könnte man sagen – ich war fasziniert von Naturphänomenen, die einen zerstörerischen Charakter annehmen können. An meiner Wand hing ein Poster von einem argentinischen Vulkan, das „Naturkatastrophen“-Was ist was habe ich eigentlich nur in die Bibliothek zurückgebracht, um es direkt wieder ausleihen zu können, und es war stets eine schwere Enttäuschung, wenn beim Familien-Zappen niemand außer mir bei den Tornado-Dokus hängenbleiben wollte. Nun ja. Und das, obwohl ich zugleich ein ziemlicher Schisser bin, sobald es das erste Mal blitzt.
Als ich etwas älter war, habe ich Katastrophen-Spielfilme für mich entdeckt – „Deep Core“, „Twister“, „Armageddon“ und vor allem „Deep Impact“.[1] Letzterer kam bei der Kritik nicht besonders gut an, es fehlte vielen wohl am Knalleffekt. Aber ich konnte nicht genug von ihm bekommen, hab ihn erst auf VHS aufgenommen, später dann sogar auf DVD gekauft, um mir immer wieder anschauen zu können, wie ein Kometenstück New York plattmacht. Nein, Scherz, es ging mir natürlich vor allem um das menschlich-psychologische Storytelling, das hier viel mehr Platz einnimmt als in vergleichbaren Filmen. Der Einschlag war zweitrangig. Ganz klar. Ja. Auf jeden Fall.
Später hat meine Begeisterung für solche Filme und ihre Themen nachgelassen. Vielleicht lag’s am Erdkunde-Unterricht,[2] vielleicht auch daran, dass Naturkatastrophen allzu real wurden, immer mehr Platz in den Nachrichten eingenommen haben und näher gerückt sind. 2021 galt das mehr denn je. Im Sommer habe ich ein Video gepostet, in dem mein Stadtviertel moderat unter Wasser stand; eine Woche später war vom wenige Fahrminuten entfernten Ahr-Tal nicht mehr viel übrig und auch sonst hatte die Welt gefühlt überall entweder zu viel Wasser oder zu viel Feuer. Man könnte also meinen, dass es nicht die beste Zeit sei, um die Liebe zu Katastrophenfilmen wiederzuentdecken. Und doch …
Katastrophen-Eskapismus
An Weihnachten hatte ich angefangen, Mary Robinette Kowals Alternate-History-Roman „Die Berechnung der Sterne“ zu lesen. Gleich auf den ersten Seiten ist hier Weltuntergangsstimmung angesagt: Ein Meteor stürzt in den Atlantik und legt die Ostküste der USA in Schutt und Asche. Die Physikerin und Pilotin Dr. Elma York und ihr Ehemann, der Ingenieur Nathaniel, entkommen der Katastrophe knapp und erreichen einen Militärstützpunkt. Hier sind sie erst einmal in Sicherheit …
… und ich habe das Buch erst einmal zur Seite gelegt. Nicht, weil es nicht spannend war – gerade der Anfang ist ein Pageturner. Aber die Beschreibung des Meteoriteneinschlags – übrigens das erste Mal, dass ich ihn literarisch beschrieben erlebt habe –, hat mich eine alte Leidenschaft wiederentdecken lassen.
Heißt: Ich habe 2022 damit gestartet, mir Katastrophenfilme anzuschauen. Auf dem Plan standen Ric Roman Waughs „Greenland“ (2020) mit Gerard Butler (Komet vs. Erde) und Brad Peytons „San Andreas“ (2015) mit Dwayne Johnson (Erdbeben und Tsunami vs. Kalifornien). Danach war mein Cringelevel schon so hoch, dass ich es mir verkneifen konnte, der Netflix-Empfehlung weiter zu „Geostorm“ zu folgen.[3]
Die beiden genannten Filme sind sich in der Grundstruktur ähnlich – in beiden haben wir einen manly man, der versucht, seine Familie und zugleich seine zuvor im Zivilisationsalltag erkrankte Ehe zu retten. „Greenland“ muss man allerdings zugutehalten, dabei auch auf soziopolitische Fragen wie Fremdenfeindlichkeit oder den Umgang mit chronisch Kranken einzugehen. Zudem liegt der Fokus eher auf den Emotionen der Figuren als auf der visuellen Darstellung der Katastrophe. Hier kommt dann doch ein bissl der 2020er-Zeitgeist raus, wenngleich die Parallelen zu „Deep Impact“ (1998) dabei sehr deutlich werden. I like!
„San Andreas“ hingegen will halt echt nicht mehr sein als brachiales Popcornkino mit ein paar Schmunzel-Momenten zwischen einstürzenden Neubauten. Der deepste Moment ist hier schon ein Gespräch zwischen dem Prota und seiner Noch-Ehefrau, in dem sie ihm vorwirft, nie den Unfalltod der Tochter verarbeitet zu haben. Und dann stürzt der Heli ab und das war’s auch erst mal wieder mit der Ruhe.

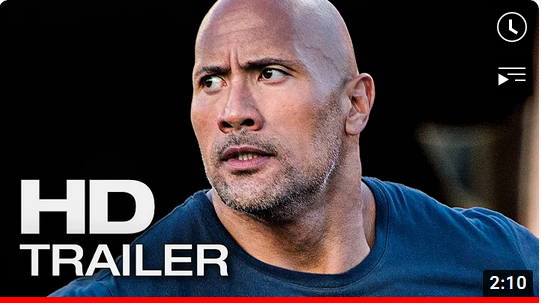
(CN für … nun ja, Katastrophen, Tod, Zerstörung)
Rückkehr ins soziale Jetzt
„Die Berechnung der Sterne“ – wozu ich zurückgekehrt bin, sobald Dwayne Johnson erleichtert in die Kamera lächeln und die US-Flagge theatralisch über dem zerstörten San Francisco wehen konnte – geht hier einen anderen Weg. Schon der Einschlag und die anschließende Flucht des Ehepaars wird zwar actionreich, aber nicht in unrealistischem Maße spektakulär beschrieben. Aber eigentlich geht es in dem Buch ohnehin nicht um die Katastrophe an sich. Denn während sich die Welt langsam von dem Einschlag und den verheerenden, aber nicht weltzerstörerischen Folgen erholt, findet Protagonistin Elma heraus, dass die eigentliche Apokalypse noch bevorsteht: Durch die Erwärmung des Meeres droht ein radikaler Klimawandel, der die Erde auf absehbare Zeit unbewohnbar machen wird. Aus diesem Grund wird ein internationales Raumfahrtprogramm in die Wege geleitet, das die Gründung von Kolonien im All ermöglichen soll.
Und das ist der Punkt, an dem das Buch von der Alternate History quasi zum Gegenwartsroman wird. Noch immer befinden wir uns in den 1950er Jahren, doch die Themen, die behandelt werden, sind im Prinzip auch die unserer Zeit und Gesellschaft.
Die Apokalypse, die von Kowal beschrieben wird, ist keine von wenigen Tagen oder Wochen. Die meisten Menschen bekommen nur mit, dass das Wetter etwas verrücktspielt, doch das Leben geht für sie weiter. Entsprechend schwindet bald der Enthusiasmus für das Raumfahrtprogramm, das zunächst scheinbar vor allem in einer Abfolge von Raketentests besteht, manche bemannt, manche unbemannt. Wenn sich Elma außerhalb ihrer Wissenschaftsblase bewegt, stellt sie fest, wie der Unwille der Bevölkerung in den USA wächst, das Programm zu finanzieren, wo die Gelder doch auch eingesetzt werden könnten, um das Land wiederaufzubauen.
Nun ist es auch ein beliebter Aspekt in Katastrophenfilmen, einen Wissenschaftler einzuführen, dessen düsteren Prognosen von Erdbeben, Kometenkonfrontationen etc. nicht oder zu spät geglaubt wird. Formen der Wissenschaftsleugnung erleben wir aktuell hautnah, Elma erlebt sie ebenfalls. Und vor allem erlebt sie, dass Wissenschaftlerinnen nicht geglaubt wird.
Im Buch ist es Elma, die als Erste herausfindet, dass die Erde vor einem Riesenproblem steht. Da ihr klar ist, dass man ihr als Frau nicht viel Glauben schenken wird, übernimmt die Kommunikation allerdings ihr Ehemann Nathaniel, wodurch das Raumfahrtprogramm erst in die Wege geleitet wird. Auch später wird es immer wieder Nathaniel sein, der – obwohl er Elma ermutigt, es selbst zu tun – die Arbeiten seiner Frau vorträgt. Die kommt zwar dank einer Wissenschaftssendung für Kinder bald zu einiger Berühmtheit und darf als Vorbild für Mädchen mit naturwissenschaftlichen Ambitionen herhalten, viel zu sagen hat sie aber weiterhin nicht. Obwohl sie alle Anforderungen erfüllt, wird sie auch nicht als Astronautin zugelassen. Das weckt jedoch ihren Kampfgeist.
Gesellschaftsroman mit Katastrophenstimmung
Elmas Kampf darum, Astronautin werden zu dürfen, bildet den roten Faden für die Handlung. Und dennoch geht es immer um mehr als das. Ja, es ist ein Buch über eine Emanzipation, aber es ist auch ein Roman über die Entwicklung einer Gesellschaft angesichts einer langsamen Katastrophe. Das apokalyptische Moment zu Anfang sorgt zunächst für einen Internationalisierungsschub, der mehr Diversität auf Elmas Arbeitsstätte mit sich bringt.[4] Das passt zu Apokalypse-Theorien, denen zufolge solche Momente immer ein Upside-Down mit sich bringen, eine Verschiebung bzw. Umdeutung und Um-Priorisierung von Werten oder Normen. In vielen Katastrophenfilmen wird das als Chaos interpretiert, als survival of the fittest-Situation mit Plünderungen und Anarchie. Man kann es aber auch positiv deuten. Als wir 2020 selbst in eine apokalyptische Phase gerutscht sind, erfreute sich z. B. ein Artikel von Laurie Penny großer Beliebtheit, in dem they festhielt, dass zuvor zum Teil eher weniger angesehene Berufsstände wie „nurses, doctors, cleaners, drivers“ die Held*innen der „Apokalypse“ seien – und nicht, wie es viele Popcornmedien prophezeit hatten, testosteronstrotzende Krieger. Zudem schien die Welt in kindness zusammenzuwachsen. Nun, zwei Jahre später, sind viele damals aufgekommene Hoffnungen allerdings zerbrochen, Entwicklungen stagnieren und weltweit stehen Gesellschaften vor starken normativen Konflikten.
Interessanterweise ist „Die Berechnung der Sterne“ im US-amerikanischen Original bereits 2018 veröffentlicht worden, die Analogien waren wohl vor allem in Bezug auf die Klimakrise angedacht; umso bemerkenswerter, wie gut der Roman zu unserer Pandemie-Situation passt. Auch in der Roman-Gesellschaft ist der Motivationsschub, die Aufbruchsstimmung nach der Katastrophe schnell verblasst. Ein bisschen was wurde erreicht, doch die Gesellschaft fährt sich wieder in ihren Normen fest. Eine Frau im Weltall? Das wird erst denkbar, als der mediale Druck größer wird. Und zugleich wird Elma lernen, dass sie als weiße Frau dennoch in einer weitaus privilegierteren Position ist als ihre taiwanesische Kollegin oder schwarze Pilotinnen, die selbst später, als Frauen zum Astronautentraining zugelassen werden, unter fadenscheinigen Begründungen das Nachsehen haben.
Man merkt schon, „Die Berechnung der Sterne“ hat sich einiges an Themen vorgenommen. Es ist ein glaubwürdig recherchierter Hard-SF-Roman. Es ist ein Gesellschaftsroman, der die heutige Klimakrise quasi beschleunigt und in die Vergangenheit verleg. Ebenso ist es ein Apokalypse-Roman, der Klischees aufgreift und sie zugleich zerbröseln lässt. Und dann ist es noch ein Roman über eine Frau, die nicht nur gesellschaftliche Schranken, sondern auch noch eine (mit ihrer sozialen Rolle in Verbindung stehende) Angstneurose überwinden muss – oder zumindest lernt, mit dieser umzugehen.
Das ist ein ganz schöner Batzen für knapp fünfhundert Seiten, und als ich gemerkt habe, wie viel sich der Roman da vornimmt, war meine Angst groß, dass er es an die Wand fahren würde. Hat er aber nicht. Irgendwie ist Kowal das Kunststück gelungen, aus all diesen Themen ein stimmiges – und spannendes! – Ganzes zu kreieren, in dem alles ineinander greift. Es gab ein paar Details, mit denen ich nicht ganz zufrieden war – was ist das etwa für eine Wunderpille, die einen nahezu nebenwirkungsfrei plötzlich die Angst vor öffentlichen Auftritten nimmt? Aber da will ich mich nicht zu sehr dran aufhängen, denn ansonsten wird das Thema im Roman schön aufgegriffen. Hut ab vor Kowals Leistung; der Roman hat schon nicht umsonst Nebula-, Locus– und Hugo-Award abgeräumt, wa.
Wenn ihr nach dieser Besprechung selbst Interesse an ihm habt: Der Roman ist kürzlich in deutscher Übersetzung im Piper Verlag erschienen und Übersetzer*in Judith Vogt bietet gerade eine Leserunde auf Lovelybooks an; die Bewerbungsrunde läuft noch.
Auf Englisch sind übrigens bereits drei Fortsetzungen erschienen, außerdem spielen mehrere Kurzgeschichten (u. a. „The Lady Astrounaut of Mars“) im selben Universum. Einzelroman-Verfechter sollten sich davon aber nicht aufhalten lassen – das Ende ist wunderbar rund.
Danke an den Piper Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplars.
[1] Übrigens ist „Deep Impact“ eine der damals wenigen SF-Großproduktionen mit Regisseurin (Mimi Leder). Ich will dem eigentlich nicht zu viel Bedeutung zumessen, könnte mir aber schon vorstellen, dass das einer der Gründe ist, weshalb der Fokus hier statt auf einem kernigen Vater-Helden auf einem Teenager und einer Journalistin liegt.
[2] Ich mochte Erdkunde, fand es aber deprimierend, weil ich die Details nicht kapiert hab. Fürchte, ich würde bei einer Naturkatastrophe zu denen zählen, die wirklich nicht viel beitragen können. Aber zumindest würde ich nicht wie der „San Andreas“-Prota einen Köpper ins trümmerübersäte Wasser machen.
[3] Hätte jetzt aber mal wieder Lust auf alternative Katastrophenfilme wie „Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt“. Oder „Melancholia“. Mal wieder so richtig die Erde untergehen lassen! Hab auch noch nicht „Don’t Look Up“ geguckt.
[4] Im Buch wird die Internationalisierung selbst als Folge des Einschlags angesehen. Allerdings betont Kowal im Nachwort zum Roman, dass sich unabhängig davon auch in unserer Realität Women of Color unter den Computergirls befanden. Siehe Buch und Film „Hidden Figures“.
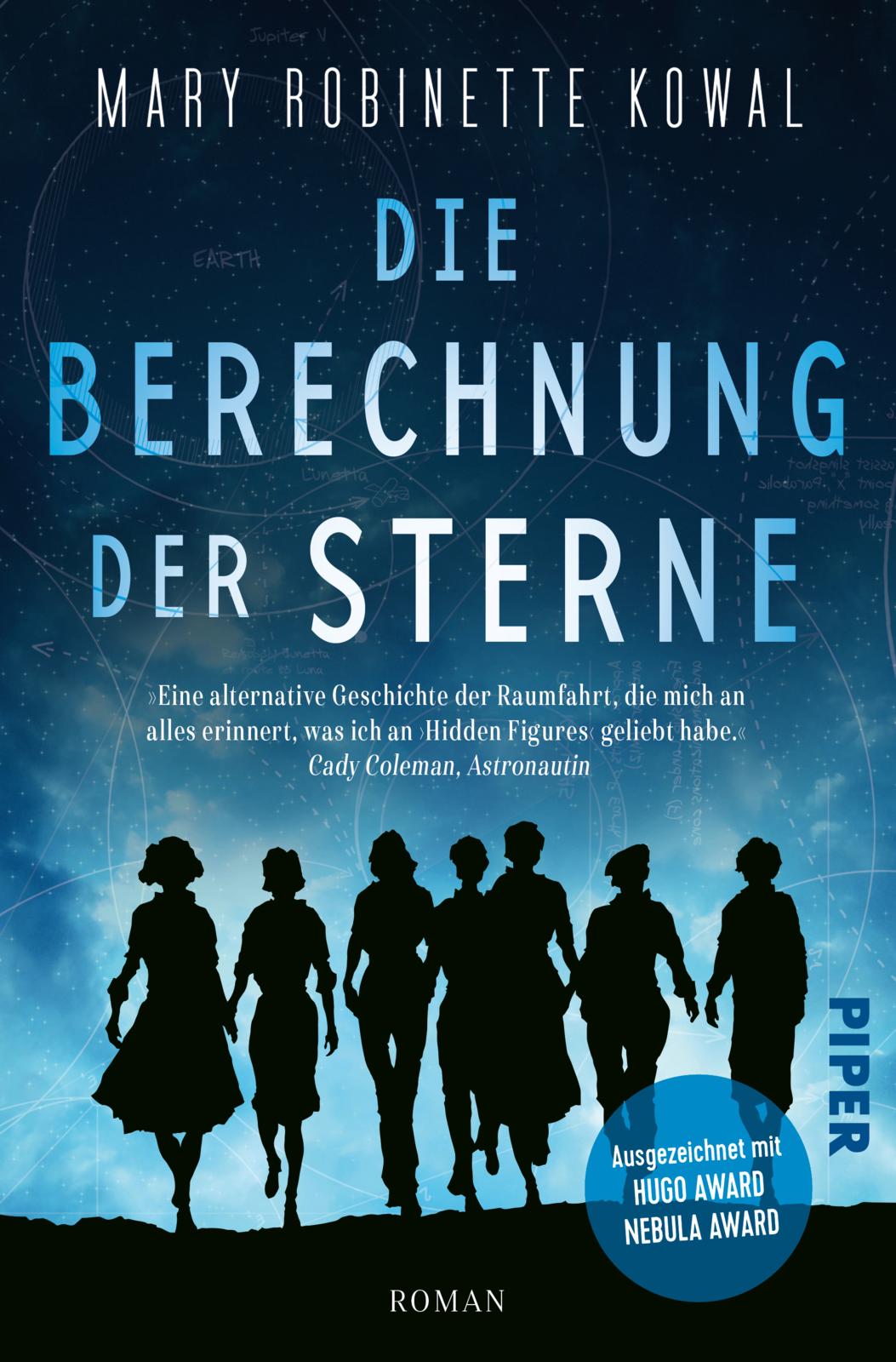
6 Gedanken zu „Katastrophen-Sternstunde“
Das klingt nach einem starken Buch. Hätte ich lieber als „Corona/Klima-Film“ gesehen als „Don’t look up“…
Bei mir war es Horror als Flucht vor Corona… Katastrophe als Eskapismus scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein…
Zumindest sowas wie „San Andreas“ ist halt auch so übertrieben, dass ich das eher wie einen Fantasyfilm gucke. Bei „The Impossible“ z. B., was während des Tsunamis von 2004 spielt, wäre es sicher was anderes, da wäre nicht viel Eskapismus dabei …
Ich hab von all deinen Filmbeispielen bisher tatsächlich nur Deep Impact gesehen… Nichtmal Armageddon. Nicht bei Erscheinen & auf Netflix hab ich so lang gewartet, bis er plötzlich weg war…
Hast nicht viel verpasst. Mit „Deep Impact“ bist du schon beim Premium-Beispiel angekommen, mit Ausnahme vielleicht von „Greenland“.