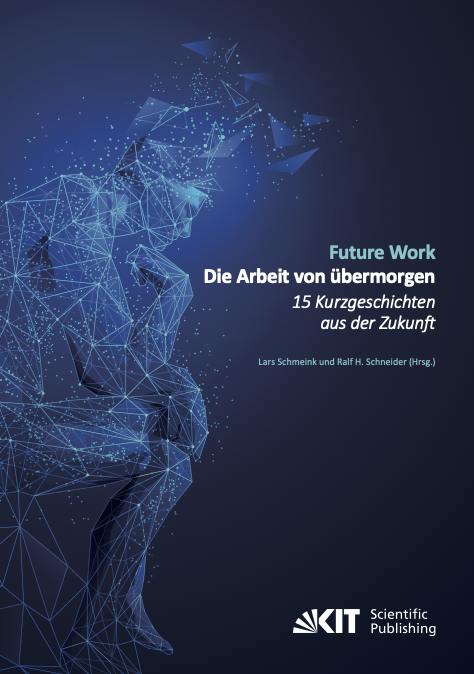
Von Zügen, Pandemiegesprächen und der Arbeit von übermorgen
Über die Liebe zur Bahnfahrt, die Hürden der Bahnfahrt, Pandemiegespräche und Cappuccino-Rituale. Oder auch: Ein ausführlicher Bericht dazu, wie es zu einer fünfseitigen Kurzgeschichten kam, die in der Anthologie „Die Arbeit von übermorgen“ erschienen ist.
Ich verbringe sehr viel Zeit in Zügen. Ich pendle mit ihnen zur Arbeit, ich besuche mit ihnen Familienmitglieder, selbst zum nächsten Rewe fahre ich manchmal mit der Bahn. Für viele aus meinem Freundeskreis ist das hier, in einer Gegend, in der die meisten aufs Auto angewiesen sind, unverständlich. Wenn sie einmal im Vierteljahr mit dem Zug fahren, geht irgendwie immer was schief – Bahnen fallen aus, Rinder stehen auf den Gleisen, Wasser- oder Schneemassen legen die Strecken lahm oder alles auf einmal.
Hab ich einfach Glück oder hat mich die hohe Fahrtenfrequenz toleranter gemacht? Natürlich habe ich auch einige nicht so tolle Erfahrungen mit der Bahn auf Lager. Wegen Streik Arbeitstermine absagen zu müssen, ist unangenehm. Wegen eines Zugausfalls bei Minusgraden nachts in der Pampa zu stranden und sich den Hintern abzufrieren, ebenfalls. Und von den unangenehmen Mitfahrenden, die einem vor allem in den Regios hin und wieder begegnen und bei denen man einfach nur froh ist, wenn sie nicht an derselben Haltestelle wie man selbst aussteigen, will ich gar nicht erst anfangen.
Dennoch liebe ich es sehr, mit der Bahn zu fahren. Nirgendwo sonst bekomme ich meine Gedanken so gut geordnet, nirgendwo sonst bin ich so produktiv.[1] Ich weiß gar nicht, wie ich es in der zugfreien Hoch-Pandemiezeit geschafft habe, überhaupt noch Blogbeiträge zu schreiben (diesen hier habe ich übrigens auch im Zug angefangen). Zugleich träume ich während der Fahrt auch mal gerne einfach vor mich hin und beobachte die Landschaft oder die wartenden Menschen an den Bahnsteigen. Und auf längeren Fahrten finde ich es unterhaltsam, zuzusehen, wie sich Zweckgemeinschaften bilden, Bekanntschaften über vier Stunden geschlossen werden und man Einblicke in Lebenswelten bekommt, die einem sonst oft verschlossen bleiben. Da war beispielsweise diese Musicaldarstellerin, die sich über Kolleginnen ausließ, die Karriere als Schlagersternchen machten. Oder der ältere Herr, der mir von seiner Lieblingsvorspeise aus einem Berliner Restaurant vorschwärmte. Einmal saß ich sogar neben einer anderen Autorin, die ihr Manuskript korrigierte und stellte daheim fest, dass ihr Name in einer Anthologie auftauchte, in der meine Schwester ebenfalls veröffentlicht hatte.
Klar romantisiere ich das nun etwas und manchmal hätte ich mir gewünscht, einfach in Ruhe Musik hören zu können, anstatt mit den Sitznachbar*innen zu quatschen. Außerdem sind da auch die oben erwähnten nicht so angenehmen Zeitgenoss*innen. Dennoch hat die teilnehmende Beobachtung dieser Gemeinschaften und Bekanntschaften auf Zeit ihren Reiz, ebenso wie das Bahnfahren generell. Vor ein paar Jahren habe ich dem mit „Holly mit Katze“ schon einmal eine Kurzgeschichte gewidmet (lässt sich über die App SmartStorys lesen), und ein schönes Essay dazu hat 2013 Joey Goebel auf Zeit.de veröffentlicht.
Im Zuge meiner Zugfahrten (höhö) mache ich mir hin und wieder Gedanken darum, wie sich meine favorisierte Fremdfortbewegungsart wohl entwickeln wird. Theoretisch wird ihr eine glänzende Zukunft vorhergesagt und ich träume von Nachtzügen nach Edinburgh und schaue mir Bjarke Ingels‘ Portal-Design für den Hyperloop an. Aber zuletzt bin ich pessimistischer geworden, weil ich bei allen Träumen im Großen die zum Haare Raufenden Probleme im Kleinen sehe. Beispielsweise arbeitet mein Vater – dem ich verdanke, an die Zugliebe herangezogen worden zu sein, auch wenn sie bei mir deutlich hedonistischer ausfällt – für einen Verein, der im Westerwald versucht, eine Bahnstrecke nach Bendorf zu reanimieren. In dieser Gegend, in der in manchem Ort vielleicht zweimal am Tag ein Bus vorbeikommt, wäre das doch nur wünschenswert, sollte man meinen. Der Widerstand und die bürokratischen Hürden sind jedoch enorm; ein Artikel darüber ist kürzlich in der FAZ erschienen (leider nicht kostenfrei lesbar). Und das ist kein Einzelfall, auch in anderen Regionen scheitern Reaktivierungsversuche oft an eigenartigsten Bedenken und vor allem an bürokratischen Hürden.
Dennoch (oder gerade deshalb?) spiele ich schon lange mit dem Gedanken, eine Zug-orientierte Not-too-far-away-Future-Geschichte zu schreiben. Eigentlich wollte ich das mit meinem aktuellen Romanprojekt realisieren, aber als ich mit dem Exposé fertig war, war der Zug daraus wieder verschwunden. Dafür kam die Ausschreibung des KIT-Projekts FutureWork, in deren Rahmen Kurzgeschichten gesucht wurden, die sich mit dem Thema Arbeit im Jahr 2100 auseinander setzen sollten. Nun hat das erst mal nur bedingt mit Zügen zu tun, aber irgendwie war mir direkt klar, dass ich dazu einen Beitrag einreichen wollte, der sich um ein Gespräch in einem futuristischen Zug rankt. Allerdings war das nur die eine Hälfte des Gemischs, aus dem die Kurzgeschichte entstand. Für die andere wechseln wir kurz zu Ranga Yogeshwar und zur Corona-Pandemie.
2019 waren Ranga Yogeshwar und Tilman Wolff an der HS Koblenz zu Besuch, meinem damaligen Arbeitsplatz, um ihren Film „Der große Umbruch“ vorzustellen und mit den Studierenden über KI und die Automatisierung der Zukunft zu diskutieren. Mir oblag es damals, die Veranstaltung zu filmen und zu schneiden. Dabei begegnete mir auch ein Filmausschnitt, in dem es um ein New Yorker Café ging, in dem nur noch eine KI bedient. In diesem Zusammenhang sagte Yogeshwar, er glaube nicht, dass Kellner*innen und Co. verschwänden, da Leute den persönlichen Kontakt schätzen würden.
Das kam mir 2020 wieder in Erinnerung. Da war nämlich gerade Lockdown und ich konnte nicht, wie es sonst eines meiner üblichen Rituale war, mich einmal in der Woche mit Notizbuch ins Café setzen und einen Cappuccino trinken. Ich konnte mich allerdings mit Notizbuch an den Fluss setzen und dort einen Cappuccino trinken. Dabei standen mir zwei Optionen zur Verfügung, um an mein favorisiertes Heißgetränk zu kommen: Zum einen gibt es hier einen Automaten, an dem man sich für einen Euro ein durchaus trinkbares Cappuccino-ähnliches Gebräu ziehen kann. Zum anderen gibt es ein Café, in dem man den Cappuccino für überschaubare 2,50 Euro to go erwerben kann. Dass ich in der Regel auf das Café zurückgegriffen habe, lag nicht nur am Geschmack oder daran, dass ich das Café lieber unterstützten wollte als den Automaten. Es lag auch daran, dass dort ein grummeliger Italiener und sein ewig gut gelaunter Sohn hinter der Theke standen und in dieser Zeit, in der ich anfangs außerhalb des Bildschirms höchstens mal meine Nachbarin gesehen habe, zwei, drei Sätze mit mir gewechselt haben. Es war nie viel, meistens eine Begrüßung und noch ein Satz Smalltalk. Aber hey, selbst mein introvertiertes Ich war um diese zwei Sätze einmal in der Woche durchaus dankbar.
Insofern denke ich, dass etwas dran ist an Yogeshwars Kommentar, dass wir weiterhin den persönlichen Kontakt beim Kaffeekauf schätzen werden. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass dieser persönliche Kontakt, da er teurer ist als die Automatenwartung, eine Sache für finanziell Priviligierte werden könnte.
Aus diesen drei Aspekten – Zugfahrten, Gesprächen und teuren Gesprächen – ist letztlich also die Geschichte „Dialog im Baltikum“ entstanden, die es tatsächlich in die Anthologie „Die Arbeit von übermorgen. 15 Kurzgeschichten aus der Zukunft“, herausgegeben von Lars Schmeink und Ralf H. Schneider, geschafft hat. Daneben sind auch Kurzgeschichten von Theresa Hannig, Heidrun Jänchen, Jol Rosenberg, Franziska Rarey, Michael Edelbrock, Sonja Hermeneit, Melanie Vogltanz, Annika Zinn, Alex Simona, Lena Richter, Karlheinz Steinmüller, Malte Aurich, Tanja Binder sowie Christian und Judith Vogt enthalten, außerdem ein Essay von Julia Grillmayr und das Vorwort von Ralf H. Schneider, Oliver Pfirrmann und Claudio Zettel.
Das Ganze ist unter Open Access erschienen, die entsprechend kostenfreie E-Book-Version lässt sich via KIT Scientific Publishing herunterladen. Der Inhalt steht zudem unter CC BY, was ich unter dem Kontext, dass die Anthologie im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts entstanden ist, sehr begrüße.[2] Eine Printversion gibt es für 25 Euro ebenfalls.
Ich wünsche viel Spaß mit den Texten.
[1] Allerdings lässt die Produktivität deutlich nach, wenn ich keinen Sitzplatz finde.
[2] Keine Ahnung, worum es sich bei CC handelt? In den Augustansichten 2020 findet ihr den Link zu meinen Folien von einem vorangegangenen Barcamp, in dessen Rahmen ich die Lizenzen vorgestellt hatte. Sieht nicht so fancy aus, weil ich das Hintergrundbild entfernt habe, aber nun, der Inhalt ist hoffentlich dennoch hilfreich. Das Ganze erinnert mich daran, dass in den Tiefen dieses Blogs auch noch ein Entwurf zu viel Für und ein wenig Wider (gebt die Urhebenden an, verdammt!) rund um die Veröffentlichung von CC-Material schlummert … Na ja, da schlummert noch so einiges.
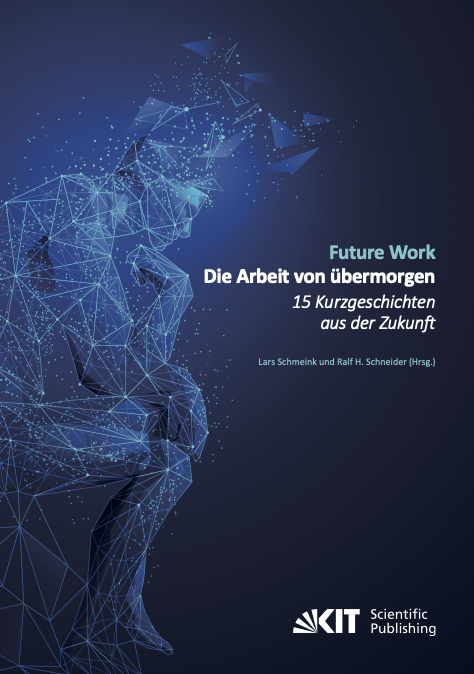
6 Gedanken zu „Von Zügen, Pandemiegesprächen und der Arbeit von übermorgen“
Vielen Dank für deine liebenswerte Hommage an die Eisenbahn. Habe mich in deinen Erzählungen an vielen Fällen wiedergefunden und kann dir nur zustimmen!
Das freut mich sehr, danke dir!