
#femaleheritage: 7 Fantasy-Autorinnen …
… der 1970er bis 1990er Jahre
Die Münchner Stadtbibliothek bzw. die Monacensia hat unter dem Titel „Frauen und Erinnerungskultur“ zu einer Blogparade aufgerufen. Es geht grob gesagt darum, verschiedenste Wirkerinnen ins Gedächtnis zu rufen. Die bisherigen Posts umfassen dazu beispielsweise Portraits von so unterschiedlichen Frauen wie Prinzessin Therese von Bayern, der Archäologin Harriet Boyd Hawes oder der Tänzerin Valeska Gert. Eine Sammlung aller Beiträge und den Originalaufruf findet ihr auf dem Blog der Münchner Stadtbibliothek.
Und hier? Verbinde ich den Aufruf mit einer Random 7 rund um für mich prägende Fantasyautorinnen.
Ich war so 11 oder 12 Jahre alt, als ich angefangen habe, mich für phantastische Genre-Literatur zu interessieren. Damals erschien mir diese keineswegs männlich dominiert. Die ersten Fantasy-Bücher habe ich aus dem von Veröffentlichungen der 1970er und 1980er Jahre geprägten SFF-Regal meines Vaters gezogen, in dem neben Robert A. Heinlein, Alan Dean Foster und Kenneth C. Flint auch Patricia A. McKillip, Marion Zimmer Bradley oder Käthe Recheis vertreten waren. Den Leuten, die ebenfalls mit dieser Goldmann-/Heyne-Fantasy zum Genre kamen – oder sie als Entwicklung miterlebt haben – sagen diese Autorinnen sicher auch heute noch was. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie im Diskurs ein wenig in Vergessenheit geraten.[1] Das ist nicht nur schade für das Werk der Autorinnen selbst, sondern verschleiert auch die Vielfalt, die Frauen schon immer ins Genre miteingebacht haben. Daher hier ein werkzentrierter Blick auf sieben dieser Autorinnen, die mir in meiner Jugend sehr wichtig waren und vor allem meinen Blick auf die Fantasy maßgeblich beeinflusst haben:
(1) Patricia A. McKillip
Patricia A. McKillip dürfte international noch immer zu den erfolgreichsten Fantasy-Autorinnen gehören. Im Gepäck hat sie mehrere World Fantasy Awards (u. a. 2008 für ihr Lebenswerk), einen Locus Award und mehrere Mythopoetic Awards, um nur mal ein paar ihrer Auszeichnungen zu nennen. Die meisten Preise entfallen dabei auf „Schatten über Ombria“, eine Art Kunstmärchen irgendwo zwischen New Weird und Sword & Sorcery.
Bekannt wurde McKillip aber vor allem durch ihre Erdzauber-Trilogie (1976-1979), die den Aufstieg des Bauern Morgon zum sogenannten Erhabenen nachzeichnet. Der zweite Band der Trilogie, „Erbin von Wasser und Feuer“, war auch mein Einstieg in die klassische Fantasy[2] und trägt sicher viel Schuld daran, dass ich heute überhaupt meinen Samstag damit verbringe, einen solchen Post für meinen Blog zu schreiben, anstatt … dunno … was machen denn andere Leute so an einem Wochenende des Jahres 2020 …?
Jedenfalls, auch wenn McKillip immer in einem Zuge mit Erdzauber genannt wird, hat sie auch zahlreiche weitere Fantasyromane verfasst. Einige davon folgen klassischen Genremustern, andere waren deutlich experimenteller. Unter diese Experimente fällt auch ihr Roman „Winterrose“, der mich als Teenager einigermaßen ratlos zurückgelassen hat, den ich aber unbedingt einem Reread unterziehen möchte. Ich glaube, dass ich heute weitaus mehr damit anfangen könnte. Erst einmal steht aber ein Reread von Erdzauber gemeinsam mit Peter Schmitt an. Ich bin wirklich gespannt, ob mich die Trilogie als Ganzes noch genauso packen kann wie früher und inwiefern ihre tropes gut gealtert sind.[3]
(2) Käthe Recheis
Von Käthe Recheis habe ich als Jugendliche zwei Romane gelesen: das IRA-Drama „London, 13. Juli“ von 1975 und den Portal-Fantasy-Roman „Der weiße Wolf“ von 1982. Letzteren haben sowohl mein Vater als auch meine ältere Schwester so gehypt, dass ich etwas überzogene Erwartungen an ihn hatte und fast enttäuscht war, als er sich als unterhaltsamer, aber aus heutiger Sicht eben auch nicht allzu außergewöhnlicher YA-Fantasy-Roman entpuppt hat. Dennoch mochte ich ihn, und „London, 13. Juli“ gehörte jahrelang zu meinen Lieblingsromanen. Dass beide von derselben Autorin waren, habe ich aber eine ganze Weile nicht kapiert. Klar stand auf beiden „Käthe Recheis“, aber nicht nur Genre-technisch, sondern auch stilistisch schienen Welten zwischen beiden zu liegen. „Der weiße Wolf“ war episch und poetisch, „London, 13. Juli“ dagegen ungleich schneller und atemloser geschrieben.
Aber tatsächlich handelte es sich bei beiden um die gleiche Käthe Recheis, die einfach verdammt vielseitig geschrieben hat. Die Österreicherin räumte in ihrer Heimat zahlreiche Preise ab, erhielt beispielsweise mehrmals sowohl den Kinder- als auch den Jugendbuchpreis der Stadt Wien, 1988 außerdem die dortige Ehrenmedaille. 2015 starb Recheis, die sich privat sehr für die indigene Bevölkerung Mittel- und Südamerikas einsetzte, in Linz.
(3) Esther Rochon
Esther Rochon ist einer der Gründe, weshalb ich seit Jahren (mit mäßigem Erfolg) versuche, mit Duolingo mein Französisch auf ein Level zu bringen, mit dem ich mir zutraue, eine Roman-Reihe in der Sprache zu lesen. Denn unglücklicherweise wurde von der franko-kanadischen Schriftstellerin Esther Rochon nur ein einziger Roman, „Der Träumer in der Zitadelle“, auf Deutsch veröffentlicht – und dieser auch noch gekürzt. Nun ist es ohnehin immer ärgerlich, wenn man eine Reihe anfängt, die nicht zu Ende geschrieben oder übersetzt wird. Aber noch ärgerlicher ist es, wenn das bei einem Buch passiert, der einen so von den Socken haut wie „Der Träumer in der Zitadelle“. Obwohl nur knapp 120 Seiten umfassend, hat mich diese Social Fantasy, die den Zerfall des Landes Vrénalik darstellt und auf Deutsch erstmals 1977 erschien, seinerzeit ziemlich fasziniert – vermutlich auch deshalb, weil das Buch einfach anders ist. Auch wenn es klar Fantasy ist, geht es nicht den üblichen Klischees auf den Leim, zeigt sich ungewöhnlich vielschichtig und funktioniert übrigens glücklicherweise auch als Einzelband.
In ihrer Heimat gehört Rochon zu den bekanntesten Fantasyautorinnen, sie gewann allein viermal den Grand Prix de la Science-Fiction et du Fantastique Québécois. Zu Rochons 65. Geburtstag spendierte die Bibliotheka Phantastika ihr einen informativen Beitrag, der u. a. die komplizierte Entstehungsgeschichte des Vrénalik-Zyklus beleuchtet. Sören Heim hat zudem eine lange Besprechung zu „Der Träumer in der Zitadelle“ veröffentlicht.

(4) Joy Chant
Über Joy Chant habe ich in diesem Blog schon häufiger berichtet, zuletzt durch den Reread von „Wenn Voiha erwacht“ von 1984 und das darüber geführte Gespräch mit Peter Schmitt.
Chant fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie Esther Rochon – erstens, weil mich beide in eine „neue“, progressivere Art der Fantasy eingeführt haben. Zweitens aber auch, weil es bei ihr lange ähnlich schwer war, Diskussionspartner*innen zu ihren Werken zu finden 😉 Mit Twitter hat sich das geändert, dort bin ich inzwischen einigen Chant-Fans begegnet. Trotzdem gehört sie zu den Autorinnen, die inzwischen leider ziemlich in der Versenkung verschwunden sind – vermutlich auch, da sie neben ihren drei Vandarei-Romanen (neben den genannten zählt dazu „Der Mond der Brennenden Bäume“) lediglich die Mythen-Nacherzählung „Könige der Nebelinsel“ veröffentlicht hat. Ihr Debüt „Roter Mond und Schwarzer Berg“ von 1977 wurde 2001 zwar noch mal von Klett-Cotta neu aufgelegt, aber nun, das ist jetzt halt auch schon wieder fast zwanzig Jahre her. Zugegebenermaßen sind Chants Romane auch nicht in allen Details so gut gealtert. Trotzdem wäre vor allem „Wenn Voiha erwacht“ eine Neuauflage zu wünschen.
Joy Chant hat die Bibliotheka Phantastika ebenfalls einen interessanten Übersichtsartikel spendiert.
(5) Margaret Weis
Der erste Fantasyroman, den ich mir selbst gekauft hatte, war „Die Stadt der Göttin” – unpraktischerweise der 8. Band der Drachenlanze-Saga, aber mir gefiel’s trotzdem gut genug, um auch noch die drölfzig anderen Bände zu lesen. Erdacht wurde die Saga in ihren Grundzügen von Tracy und Laura Hickman, aber geschrieben hat Tracy[4] dann zumindest die ersten Bände mit Margaret Weis. Die war seit 1983 feste Autorin und Redakteurin bei TSR, unter deren Fittiche die Drachenlanze-Reihe als Teil des D&D-Multiversums entstand, und sollte dem Ganzen wohl eine gewisse schriftstellerische Qualität und Balance verpassen. Das klappte gut: Rückblickend ist die Drachenlanze-Saga kein qualitativ besonders herausragendes Beispiel für Genre-Literatur, inhaltlich sogar zuweilen problematisch.[5] Aber sie verstand es zu unterhalten, hat meines Wissens als eine der ersten Reihen eine Figur mit chronischer Krankheit in die Heldentruppe eingeführt und ein Gespür für mitreißende Figurenzeichnung gehabt.
Zu verdanken ist das einerseits dem Ideenreichtum der Hickmans, andererseits aber auch dem im besten Sinne massentauglichen Stil von Margaret Weis. Später schrieb sie auch einige Bände allein oder gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Don Perrin, und obwohl im Laufe der Zeit zahlreiche Autor*innen an dem Shared Universe mitgewirkt haben, wird es doch nach wir vor vor allem mit Weis und Hickman verbunden. Für 2020 war sogar eine Art Reboot aus beider Feder angedacht, der jedoch vom gegenwärtigen Rechteinhaber Wizards of the Coast gecancelt wurde. Aktuell läuft dazu ein Verfahren, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr.
Außerhalb von Drachenlanze schrieb Weis weitere Reihen (u. a. Die Vergessenen Reiche[6], Die Rose des Propheten), vor allem im Bereich High Fantasy und oft in Co-Autorenschaft, u. a. mit Tracy Hickman, Don Perrin, Robert Krammes oder ihren Kindern David Baldwin und Lizz Weis. Mit ihrer Tochter veröffentlichte Weis auch eine Reihe, die mehr Richtung Dark Fantasy bzw. Paranormal Romance ging. Elemente beider Spielarten gelangten auch in den War of Souls (dt. Die Jünger der Drachenlanze), aber dieser Versuch einer Frischzellenkur konnte Drachenlanze nur bedingt ins neue Jahrtausend hieven.
Abseits ihrer Tätigkeit als Autorin hat Weis mit Sovereign Inc. und Margaret Weis Productions zwei Rollenspielfirmen gegründet.
(6) Jean Rabe
Nachdem Margaret Weis, Tracy Hickman und deren diverse Co-Autor*innen wegen Differenzen mit TSR die Drachenlanze-Reihe nach Dragons of Summer Flame (dt. Teil von Die Erben der Drachenlanze) zunächst verließen, kam Jean Rabe an Board. Sie schrieb die Dragons of a New Age-Trilogie, ehe Weis und Hickman zurückkehrten, um den War of Souls einzuläuten.
Als „Zwischenautorin“ hatte Rabe einen undankbaren Job. Die Fans waren sauer und kritisierten die Wahl von Rabe sowie deren Schreibstil. Zugegebenermaßen konnte dieser nicht an den von Weis und Hickman heranreichen, aber schlecht waren ihre Bände trotzdem nicht. Zudem führte Rabe – ebenso wie zuvor Weis feste Autorin und Redakteurin für TSR – die Reihe konsequent weiter und brachte ein paar neue Elemente ein.
Rabe ist eine typische Shared-Universe-Autorin, die u. a. auch Storys zu Star Wars oder den Forgotten Realms beigesteuert hat. Zudem war sie Herausgeberin und Chefredakteurin des BattleTech-Magazins MechForce Quaterly, später auch des SFWA Bulletins. Aus dieser Funktion zog sie sich allerdings zurück, nachdem im Magazin u. a. eine Kolumne von Mike Resnick und Barry Malzberg zu heftiger Kritik und Sexismus-Vorwürfen geführt hatte.
(Und mir fällt gerade auf, dass zumindest ihre Drachenlanze-Romane erst Mitte der 1990er Jahre erschienen sind, also wird das hier wohl keine 1970er/1980er-Liste, wie ursprünglich geplant …^^)
(7) Eva (Bauche-)Eppers
Die Bitburgerin Eva Bauche-Eppers ist in Deutschland eher als Übersetzerin von Autor*innen wie China Miéville, Tanith Lee oder Michael Moorcock bekannt geworden, wurde dafür auch zweimal mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. Als Autorin (und unter den Namen „Eva Christoph“ oder „Eva Eppers“) hat sie einige Terranauten-Heftromane sowie 1981 die Novellensammlung „Wanderer unter dunklen Himmeln“ veröffentlicht. Letztere war ebenfalls eine meiner Einstiegsdrogen. Mit ihrem nihilistischen Touch (Grimdark sagte mir damals noch nichts) kam ich zwar nicht immer klar, aber vor allem die Geschichten „Tagila“ und das namensgebende, sehr melancholische „Wanderer unter dunklen Himmeln“ fand ich überzeugend genug, um sie mehrmals zu lesen und … abzuschreiben o.O.[7] Kürzlich hat der Apex Verlag die Novellensammlung noch einmal neu herausgebracht und wer weiß, vielleicht veröffentlicht Bauche-Eppers ja auch noch mal etwas Neues. Soweit ich sie in Erinnerung habe, passen ihr Stil und ihre Novellen jedenfalls noch immer gut zum Zeitgeist.
Es hätte noch eine Reihe weiterer Autorinnen gegeben, die ich in dieser Liste gerne erwähnt hätte. Beispielsweise Susan Cooper, die es mit „The Dark is Rising“ kürzlich in die Times-Liste der 100 besten Fantasyromane gebracht hat. Aber nun, es ist im Grunde ein gutes Zeichen, wenn hier nicht Platz für all meine SFF-Starterpack-Autorinnen ist 😉 Trotzdem, wen vermisst ihr bzw. welche Autorinnen müssten für euch dabei sein?
[1] Ausgerechnet Marion Zimmer Bradley einmal ausgenommen.
[2] Hatte lange einfach ein großes Talent dafür, nicht zu checken, was Band 1 ist.
[3] Einerseits erinnere ich mich an keinen anderen Fantasyroman, der eine so coole Heldinnen-Truppe wie „Erbin von Wasser und Feuer“ gehabt hätte. Wann sonst hatte man eine Queste, die nur von weiblichen Figuren ausgeführt wurde?! Andererseits ist es aus heutiger Sicht kinda weird, dass Rendel den ganzen Scheiß auf sich nimmt, um ihren „Geliebten“ zu retten, den sie im Grunde kaum kennt und der sie bei einem Spiel gewonnen hat.
[4] Fun Fact: Hielt auch Tracy Hickman lange für eine Frau.
[5] Wobei „aus heutiger Sicht“ es auch nicht ganz trifft; über das White-Savior- und Missionierungsmodell, das inbesondere mit Goldmond und den „Barbaren“ gefahren wurde, wird seit mindestens 15 Jahren diskutiert.
[6] Nicht zu verwechseln mit Forgotten Realms …
[7] Weiß auch nicht, was mich damals geritten hat, aber ich hab „Tagila“ echt mal in ein (großes) Notizbuch abgeschrieben. Ebenso wie „Der Sohn der Sidhe“. Was man halt so macht mit 13.
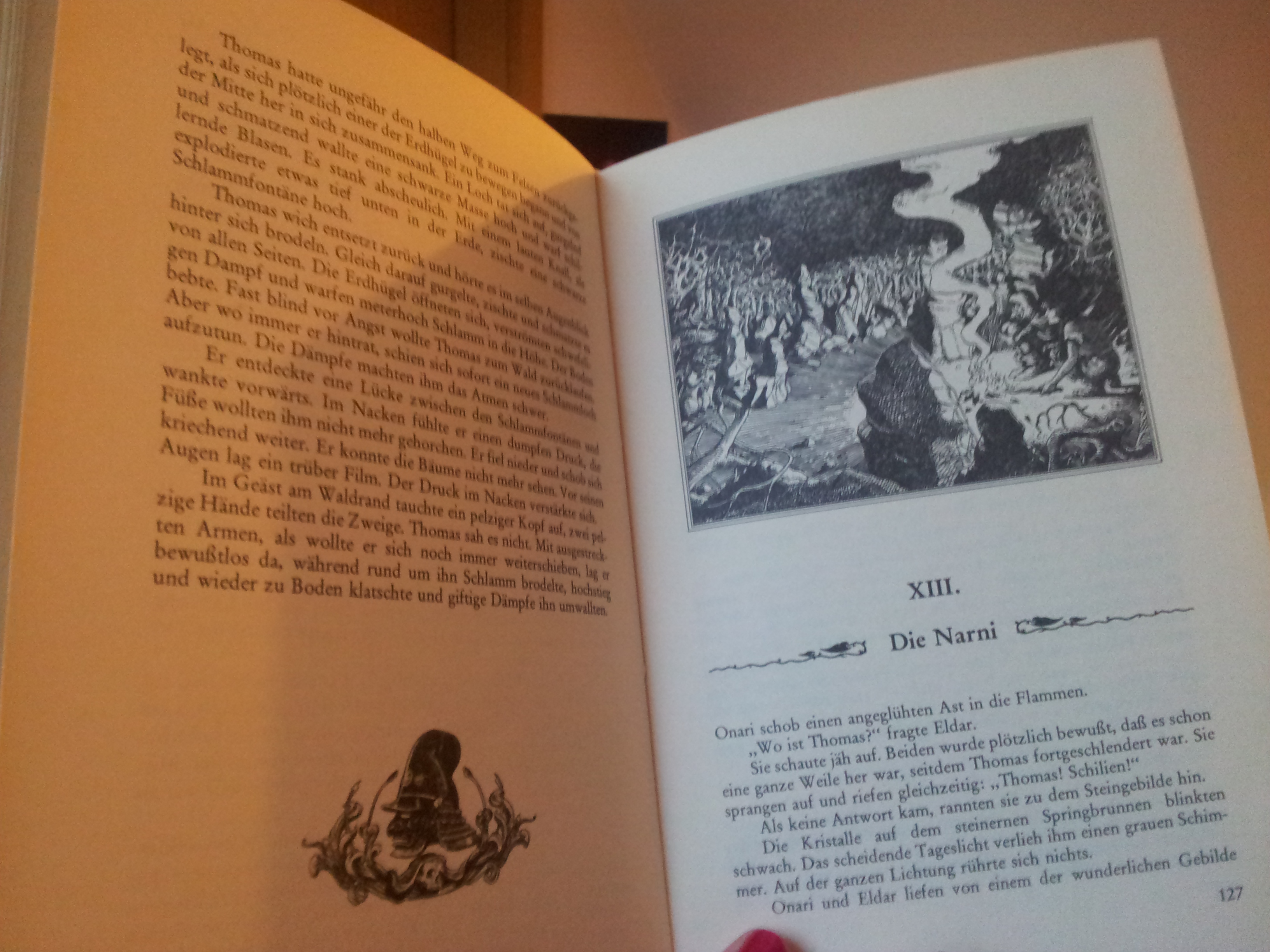
14 Gedanken zu „#femaleheritage: 7 Fantasy-Autorinnen …“
Das Französisch von Rochon ist echt nicht so schwierig… Ich hab mittlerweile noch 2 Romane aus der Reihe gelesen und irgendwann auch mal Rezensionen diktiert… die sind dann aber in dem Status stehengeblieben & ich werde tief graben müssen, um sie zu finden. Müsste ich aber mal, auch um weiterlesen zu können. Bin wohl schon in diesem Vergesslichkeitsalter. Gute Bücher, nach meiner Erinnerung, aber nicht mehr ganz so gut wie das erste. Auch länger… irgendwie werden die Einzelbände immer länger…
Wahrscheinlich müsste ich es auch einfach mal ausprobieren. Hab ein paar Mal französische Magazine gelesen, das ging einigermaßen. Verstehe nicht jeden Satz, aber schätze, auf den Status komme ich auch nicht, solange ich nicht gezwungen bin, Französisch im Alltag zu sprechen oder so …
Worüber hast du die Bücher denn bezogen?
Die gab es relativ günstig für Kindle. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das dritte auch schon gelesen hab… hab die Besprechung vom 2. gefunden, die vom dritten nicht… Hab das entweder kurz nachdem ich in Frankreich auf der Hochzeit meines Cousins so grandios an dessen Ankündigungen („Mit dem könnt ihr über Literatur und Philosophie reden“) gescheitert bin, oder davor schon angefangen. Seitdem mach ich auf jeden Fall Französisch-Tandem, das Sprechen war mir schon ziemlich eingeschlafen…
(Vorteil beim eBook ist hier definitiv auch, dass man sich Vokabeln direkt anzeigen lassen kann…)
Hmm, ich bevorzuge normalerweise Print, aber die Sache mit den Vokabeln ist ein bedenkenswerter Punkt …
Ich bin auf deine Besprechung zu Band 2 gespannt. Werde sie mir am Wochenende zu Gemüte führen, dann hab ich den Kopf freier. Oder spoilerst du gar sehr?^^
Puh, ich weiß nicht ob sich so sehr spoilere. Die groben Züge der Handlung beschreibe ich eigentlich immer, ich geh eigtl davon aus, dass sich Kunst nicht spoilern lässt. Aber viel verrate ich nicht & letztlich ist mE der Plot in diesen Büchern sowieso so angelegt, dass man die Entwicklung erahnen kann, wall ja immer ganz viel Prophezeihung und Schicksal im Hintergrund mitspielt & der Twist eher einer derart ist, dass Menschen sich mit ihrem Glauben diese Ketten des Schicksals selbst schmieden (das jetzt auch sehr allgemein gesprochen, nicht als Plotdetail verstanden). Der Link steht, für alle die vll mitlesen & den Text auch lesen wollen, unten als Pingback.
Die Printausgaben sind auch ziemlich günstig, hatte am WE nochmal nachgeschaut.
Eine interessante Auswahl, die du da zusammengestellt hast, auch wenn mindestens zwei der genannten Autorinnen jetzt keine große Überraschung sind (wenn man deinem Blog folgt bzw. wenn ich an unseren gelegentlichen Austausch denke). Witzigerweise habe ich vor kurzem auch mal in Esther Rochons Le Rêveur dans la Citadelle reingelesen und festgestellt, dass ich dem Text in groben Zügen folgen kann. Aber natürlich verstehe ich längst nicht alles, und sämtliche stilistischen Feinheiten bleiben auch auf der Strecke. Andererseits hat mich das mal wieder angespornt, meinen vor einiger Zeit gefassten Plan, mein Französisch zu entrosten, endlich etwas ernsthafter anzugehen (momentan „übe“ ich nur dann und wann mit Comics), denn es gibt schon ein paar Bücher, die ich gerne lesen (können) würde, und an eine Übersetzung der betreffenden Werke glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Die Rochon-Romane sind tatsächlich erstaunlich preisgünstig (auch als TB – ich mag keine eBooks); ich vermute, weil sie aus Kanada und nicht aus Frankreich kommen. So gesehen ist die Hürde eigentlich niedrig genug, dass ich mal drüberspringen könnte … 😉
Danke übrigens für die Links zu unseren Blogbeiträgen. Ich frage mich allerdings, warum du zwar unsere Texte zu Joy Chant und Esther Rochon verlinkt hast, aber nicht die zu Käthe Recheis und Margaret Weis – waren die beiden letztgenannten zu schlecht? (Nee, Quatsch, du kannst natürlich verlinken, was du willst; ich war nur ein bisschen verblüfft, weil ich mir ziemlich sicher war, dass wir auch was zu Recheis und Weis geschrieben haben. Und vier von sieben klingt halt irgendwie besser als zwei von sieben. ;-))
Patricia McKillip und Eva Eppers hätten eigentlich auch schon lange drankommen sollen, nur hat die eine dummerweise am 29. Februar Geburtstag, und von der anderen hatten wir bis vor kurzem kein konkretes Datum, und bislang kommen die Texte ja nur aus einem konkreten Anlass (eben einem Geburtstag) … oder auch nicht. Jean Rabe hingegen ist nicht so mein Fall. (Ich war schon zu alt bzw. hatte schon zu viele andere Sachen gelesen, um an den Drachenlanze-Bänden großen Gefallen zu finden. Weis/Hickman haben ja dann später außerhalb des Drachenlanze-Universums zumindest einen doch sehr ordentlichen Zyklus geschrieben, wohingegen Rabe afaik immer in irgendwelchen Franchise-Welten geblieben ist, und die interessieren mich fast nie.)
Mir würden natürlich noch ein paar andere Autorinnen einfallen, die ich in den 70ern und 80ern gern gelesen habe und die mir teilweise noch heute wichtig und lieb und teuer sind. Aber da ich deren Auftauchen auf dem deutschen Buchmarkt ja zeitnah miterlebt habe, will ich in der Hinsicht lieber noch anderen Leuten den Vortritt lassen, die – ähnlich wie du – auch erst später ins Genre eingestiegen sind. (Ich fürchte allerdings, die meisten sind heute tatsächlich vergessen, was in einigen Fällen mMn schon sehr schade ist.)
Oh, ich hab nicht gesehen, dass ihr zu Recheis und Weis Artikel habt. Aber ich hab die beiden Beiträge zu Rochon und Chant auch vor allem deshalb verlinkt, weil es ansonsten im deutschsprachigen Netz nicht so viel zu ihnen gibt. Daher habe ich auch Sörens Besprechung vom „Träumer in der Zitadelle“ verlinkt; klar gibt es auch z. B. zu „Drachenlanze“-Romanen etliche gute Rezensionen, aber eine ausführliche Besprechung zu Rochon ist schon eine speziellere Nummer.
Ich finde es wirklich interessant, wie der Bekanntheitsgrad der genannten Autorinnen zwischen den Generationen variiert. Merke auch an den Reaktionen in den sozialen Netzwerken, wie da eine klare Linie verläuft: Für die „älteren“ Fans gehören zumindest Patricia A. McKillip und Margaret Weis selbstverständlich zu den Großen der Fantasy. Aber den jüngeren, die eher mit der YA-Welle ab „Harry Potter“ aufgewachsen sind, sagen die oft gar nichts mehr. Einerseits ist das vermutlich verständlich, weil dafür eben andere Namen ins Rampenlicht gerückt sind. Andererseits ist es in mehrfacher Hinsicht schade.
Was Jean Rabe angeht: Ich würde sie jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsautorinnen zählen, außer der einen Trilogie (die hier als Sechsteiler veröffentlicht wurde), habe ich nichts von ihr gelesen. Aber sie hat mir immer etwas leid getan, weil sie so mit dem Backlash aus der Drachenlanze-Community zu kämpfen hatte, obwohl sie ja nun nichts dafür konnte, dass sich ihr Arbeitgeber mit Hickman/Weis verkracht hatte. Ich glaub, ich hab sie hauptsächlich deshalb in die Liste aufgenommen 😉