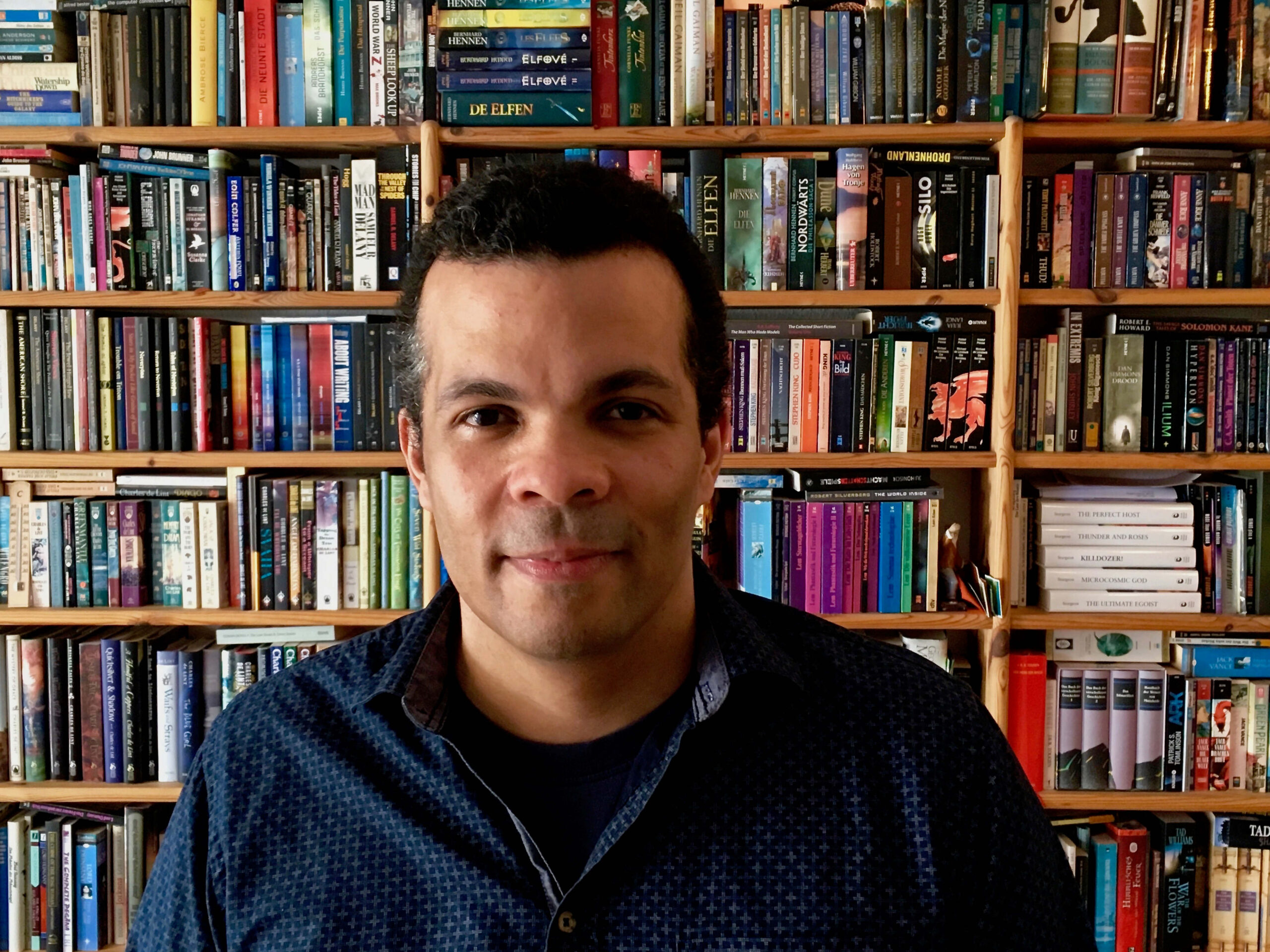
Veränderungen und stuff pt 1: James Sullivan
Früher habe ich sehr gerne Interviews geführt. In den letzten Monaten hat dafür allerdings die Zeit gefehlt, weshalb ich mein Vorhaben, eine neue Interviewreihe zu starten, immer weiter nach hinten geschoben habe. Nun ist es aber endlich soweit: Drei Jahre nach „Früher war alles anders“ startet mit „Veränderungen und stuff“ eine neue Interviewreihe.* Wieder geht es um Entwicklungen und Veränderungen, aber dieses Mal stehen nicht die eines einzelnen Projekts im Fokus, sondern solche, die der/die Schriftstellende im Laufe verschiedener Projekte bzw. seiner/ihrer Karriere insgesamt durchlaufen hat. Geplant sind wieder sieben Folgen und ich freue mich sehr, dass es heute mit James Sullivan los geht.
James‘ Name ist mir erstmals ins Auge gefallen, als er 2004 als Co-Autor von Bernhard Hennen in „Die Elfen“ auftauchte. Damit dürfte er bis heute für die meisten eng verwoben sein, zumal er neun Jahre später mit „Nuramon“ noch einmal in die „Elfen“-Welt zurückkehrte, um einen offenen Handlungsstrang zu Ende zu führen. Doch auch außerhalb dessen hat er einige Romane aus den Bereichen Fantasy und Science Fiction verfasst, zuletzt erschien 2019 „Die Stadt der Symbionten“. (Aktuell kann man sich übrigens auch zu einer Lovelybooks-Leserunde für seinen SF-Roman „Chrysaor“ anmelden.)
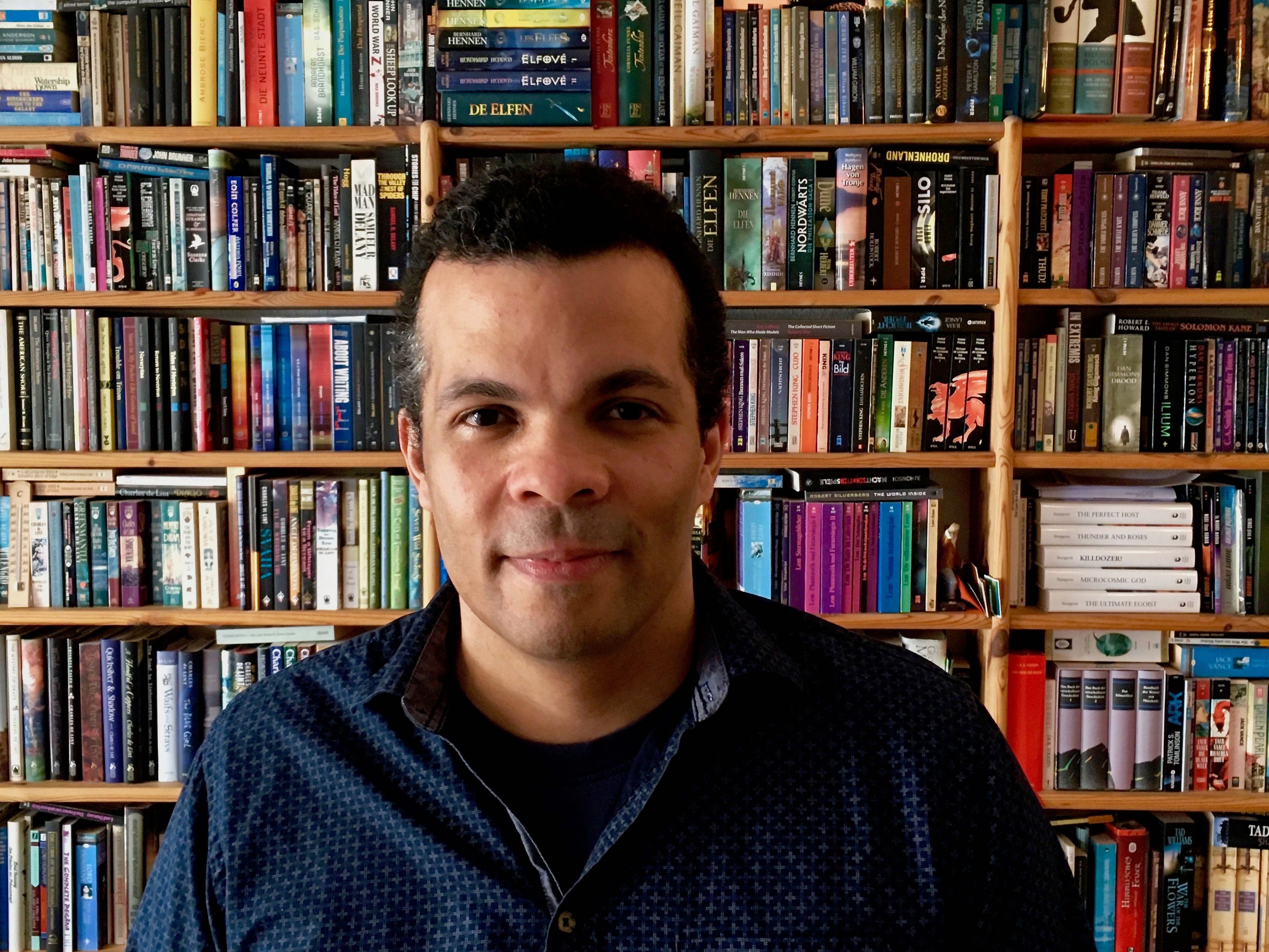
„Kennengelernt“ habe ich ihn vor ein paar Jahren über Twitter, wo er als @fantasyautor über SFF und Popkultur, oft aber ebenso über das aktuelle Tagesgeschehen oder Themen rund um Diversity berichtet. Und obwohl er sich selbst mal als „Fürst der Stubenhocker“ bezeichnet hat, ist er immer häufiger auch auf Cons und Barcamps anzutreffen. (Wenn sie denn stattfinden.)
Interview
1. Lieber James, bekannt geworden bist du als Mit-Autor von „Die Elfen“. Mit „Nuramon“ und „Der letzte Steinmagier“ hast du diesen Weg fortgeführt, bevor du mit „Chrysaor“ ins SF-Fach gewechselt bist. Wie kam es dazu?
Science Fiction und Fantasy lagen für mich immer nahe beieinander. Ich habe immer beides gelesen; beides hat mich als Autor geprägt. Meist war es so, dass mich die Science Fiction eher auf motivischer und erzählerischer Ebene beeinflusst hat und in meine Fantasy-Texte Eingang fand – zum Beispiel die Zeitreisen bei „Die Elfen“ oder die Erzählweise von „Nuramon“, die sich teilweise an bestimmten Science-Fiction-Romanen orientiert. Inhaltlich hatte ich zahlreiche SF-Ideen, aber sie reiften einfach langsamer als die Fantasy-Ideen.
Die Grundidee zu „Chrysaor“ hatte ich schon in den 90ern, und sie hat sich über die Jahre immer wieder verändert. Als „Nuramon“ Ende 2013 erschien, arbeitete ich eigentlich an einem Fantasy-Projekt, aber Anfang 2014 hatte ich wieder einmal Einfälle zu dem alten Science-Fiction-Stoff und machte dann Seiten über Seiten Notizen, die das Projekt komplett umwälzten und ihm eine neue Richtung gaben. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass der Stoff nun reif war, verfolgte ich ihn nicht weiter – vor allem deswegen, weil ich das Fantasy-Projekt nicht zurückstellen wollte. Ich war zudem nicht sicher, ob es klug wäre, das Subgenre zu wechseln. Also legte ich die Notizen zur Seite.
Ein paar Monate später fragte mich mein Literaturagent, ob ich mir vorstellen könnte, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben. Ich erzählte ihm natürlich von „Chrysaor“, und er meinte, ich sollte unbedingt ein Exposé dazu schreiben. Das machte ich dann, und ein paar Monate später rief mich mein Agent von der Frankfurter Buchmesse aus an und fragte, ob ich bereit wäre, „Chrysaor“ beim Piper Verlag zu machen. Was für eine Frage? Natürlich wollte ich das. Ich sagte also zu, und seither schreibe ich auch Science Fiction.
2. Inwiefern haben persönliche Veränderungen bzw. Veränderungen in deinem Umfeld, z. B. auch gesellschaftlicher Art, Einfluss auf deine Werke genommen?
Meine Erfahrungen und mein Blick auf die Welt prägen natürlich meine Texte, und damit wirken sich Veränderungen auch auf sie aus. Gesellschaftliche Veränderungen und die aktuellen Debatten spielen dabei natürlich eine Rolle. In den Fantasy-Romanen ist das eher verschlüsselt, wie etwa das Verhältnis von Individuen zur Gesellschaft und die Zwänge, die Gesellschaft ausübt. Bei den Science-Fiction-Romanen ist es weniger verschlüsselt. Da werden alle, die feststellen, dass es z. B. bei „Die Granden von Pandaros“ ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, sofort erkennen, auf welche Diskussionen das anspielt. Die letzten Jahre waren für mich ernüchternd. Früher dachte ich, gesellschaftliche Errungenschaften würden nicht ohne weiteres zurückgedreht werden können. Aber ich merke, dass alles wieder und wieder zur Debatte gestellt wird – am Ende sogar die Demokratie. Und natürlich fließt so etwas in meine Texte ein. Deswegen trägt zum Beispiel „Die Stadt der Symbionten“ dystopische Züge. Aber da ich immer davon ausgehe, dass wir am Ende die Errungenschaften verteidigen können, verharrt auch der Roman nicht in der Dystopie.
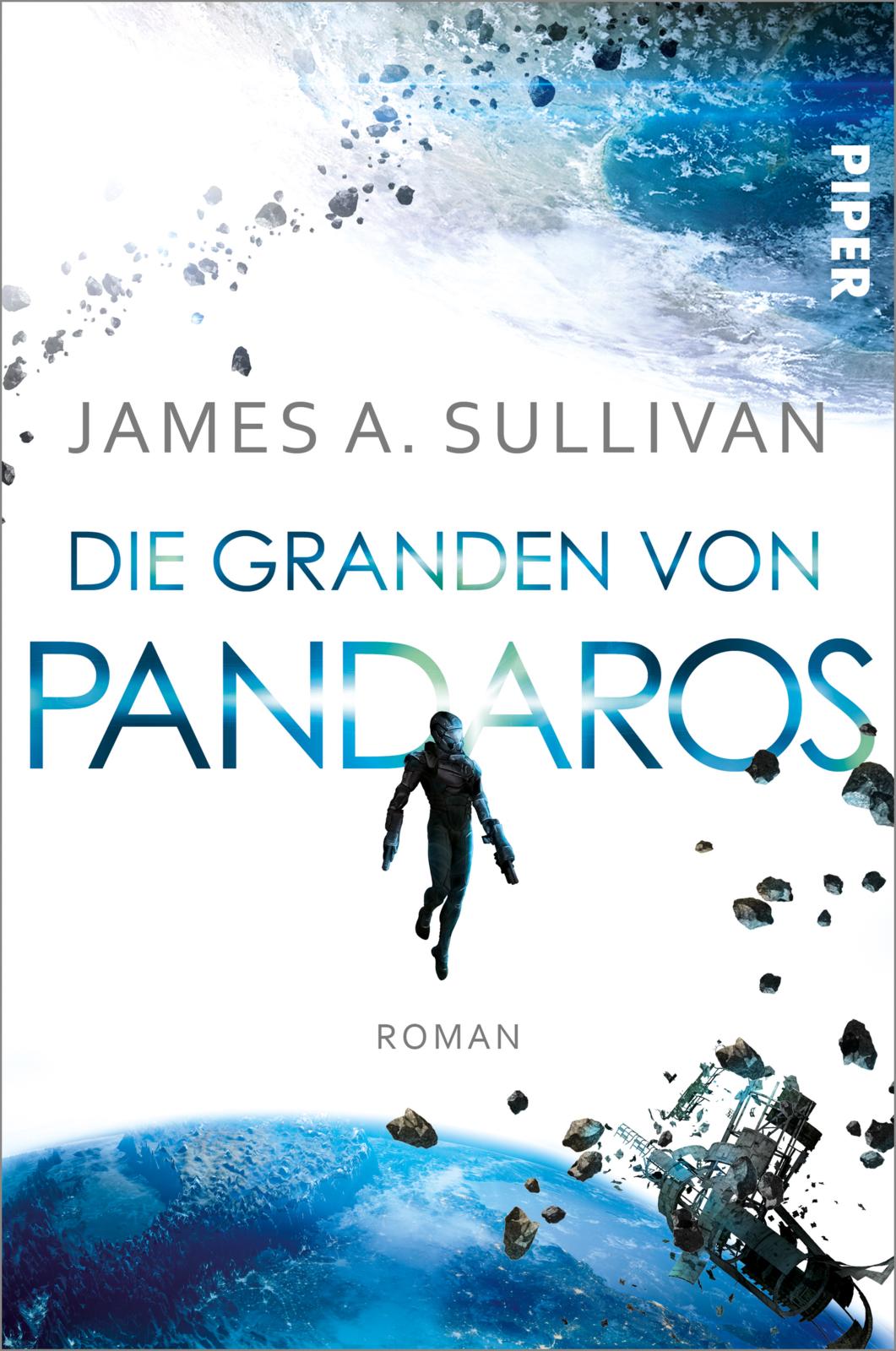
(Piper, EAN 978-3-492-97883-5)
Als Beispiel für Veränderungen in meinem persönlichen Bereich, die sich auf meine Texte ausgewirkt haben, eignet sich „Nuramon“ – wegen des Stellenwerts, den Familie in dem Roman hat. Ich bin 2010 zum ersten Mal Vater geworden, und das hat mein Leben komplett verändert. „Nuramon“ ist im Grunde ein Familienroman, der vieles abbildet, was ich damals als Vater erlebt habe. Natürlich ist das alles extrem verschlüsselt und nicht 1:1 übertragbar. Aber dafür ist die Phantastik ja da – um auf andere Weise von der Wirklichkeit zu erzählen.
Über die Jahre hat sich meine Herangehensweise aber auch verändert. Habe ich meine Fremdheitserfahrungen als Schwarzer Mensch in Deutschland bei „Die Elfen“ noch bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt, indem ich sie auf die Figur Nuramon abgebildet habe, war es mir später wichtig, Menschen, die so aussehen wie ich, sichtbar zu machen. Ab dem Roman Nuramon herrscht deutlich mehr Diversität in meinen Büchern. Ab da verschlüssele ich nicht mehr so stark, wenn ich meine Fremdheitserfahrungen abbilde. Im Grunde ist das ein Öffnungsprozess, der sich auch in meinem Leben vollzog. Bei „Die Elfen“ war ich als Co-Autor beinahe unsichtbar, und für mich war das damals wirklich wichtig, weil mir diese Unsichtbarkeit auch einen Schutz bot. Wer sichtbar ist, ist auch angreifbar, und ich war mir nicht sicher, ob ich das damals sein wollte. Mit der Zeit öffnete ich mich dann aber. Vor allem Twitter fand ich dabei sehr hilfreich. Es ist zwar sehr chaotisch, aber ich habe darüber viele Kolleg*innen kennengelernt. Und einige waren überrascht, dass es mich tatsächlich gibt, denn meine Daten klingen schon sehr nach einem Pseudonym. Aber das ist eine andere Geschichte.
Neben Twitter und Veranstaltungen wie dem Buchmesse Convent war auch das Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN) für mich wichtig. Das hat mir ein ganzes Stück aus der Isolation herausgeholfen. Ich merke allerdings allmählich, dass ich kein Vereinsmensch bin und mich in loseren Strukturen wohler fühle.
3. Hast du unveröffentliche Manuskripte? Worum ging es darin? Könntest du dir vorstellen, diese Geschichten (ggf. in überarbeiteter Form) heute noch zu veröffentlichen?
Es gibt bei mir einige unveröffentlichte Texte. Das sind in erster Linie Fantasy-Projekte, die nie zum Zuge kamen – zum Beispiel ein kleiner Fantasy-Abenteuer-Roman, der eine Mischung aus „Die drei Musketiere“ und „Robin Hood“ ist und eine außergewöhnliche Erzählweise hat. In der ursprünglichen Form würde ich das heute nicht veröffentlichen, aber zwischen Romanen oder auch einfach mal zur Ablenkung greife gerne zu diesen alten Projekten und überarbeite sie. Sie sind wie Häuser, an denen ich baue, die aber irgendwie nie fertig werden. Das gilt auch für Langzeitprojekte, die ich immer wieder aufgreife. Es ist spannend nachzuschauen, wie sich die Sachen entwickelt haben. Daran lese ich ab, wie ich mich selbst als Autor verändert habe. Und sollte sich ein Verlag für einen der Stoffe interessieren, bin ich mir sicher, dass sich alles noch einmal verschieben wird.
4. Was würdest du an früheren Werken gerne ändern?
Da die Leser*innen die Texte so kennen, wie sie sind, hätte ich Skrupel, größere Dinge zu ändern. Aber wenn ich eines ändern dürfte, ohne dass sich die Leute vor den Kopf gestoßen fühlten, dann würde ich in „Die Elfen“ dafür sorgen, dass die Figur Obilee – eine Vertraute der verbannten Zauberin Noroelle – nicht einfach nur Nuramon, Farodin und Mandred gewähren lässt, als diese gegen den Willen der Elfenkönigin ins Abenteuer ziehen, sondern dass sie sie auf der Suche nach Noroelle begleitet. Während es Farodin und Mandred später zu den Trollen verschlägt, würden Nuramon und Obilee nach dem Orakel Dareen suchen. Aber so eine Änderung wäre ein viel zu starker Eingriff. Und das würde ich den Leser*innen nicht zumuten. Aber was hindert mich daran, eine Alternativgeschichte für mich ganz allein zu schreiben? In meinem Kopf leben ohnehin allerlei Varianten der Projekte.
5. Worauf bist du stolz, bezogen auf deine Werke?
Auf Dinge, die den meisten nicht auffallen oder die sie sogar ablehnen, die ich hingegen zu schätzen weiß. Ich habe zum Beispiel für „Nuramon“ von einem Teil der Leser*innen unglaublich viel Prügel bezogen. Aber ich bin glücklich und stolz auf den Roman, weil ich darin Sachen mache, die man eigentlich nicht machen soll, die aber zu den Voraussetzungen des Romans passen. Ich erzähle da im Grunde einen Stoff, der ohne Probleme drei bis sechs Bücher füllen könnte, in einem Band und nutze dafür allerlei erzählerische Mittel. Es beginnt schon mit einem Erzählrahmen, bei dem ich die Erzählerin inhaltlich als Orakel etabliere, das durch die Sinne längst verstorbener Leute blicken kann und einer Hofgesellschaft die Geschichte von Nuramon erzählt. Die Erzählerin variiert dann immer wieder das Verhältnis zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit (also die Zeit, die in der Erzählwelt vergeht, gegenüber der Zeit, die man zum Lesen braucht), bleibt aber immer der jeweiligen Perspektive treu. Dann gibt es Zwischenkapitel (Orakelblicke), bei denen die Erzählerin schlaglichtartig die Perspektiven von Figuren zeigt, die seltener oder sonst gar nicht zum Zuge kommen. Zudem orientiere ich mich an einigen Science-Fiction-Romanen der 50er und 60er Jahre, die auf wenig Raum viel Handlung vermitteln – meist durch eine geschickte Schnitttechnik und durch ein Wechselspiel der Perspektiven. Beispiele sind: Alfred Besters „The Stars My Destination“, Theodore Sturgeons „To Marry Medusa“ und Samuel R. Delanys „The Fall of the Towers“. Dazu kommen noch die Einflüsse der Literatur des Mittelalters – insbesondere Wolfram von Eschenbach, der mich schon früher mit seiner Erzählweise beeindruckt hat, die schonungslos den Erzählzwängen folgt, die die Geschichte selbst aufgebaut hat. Und dass ich das alles nicht nur in der Schreibphase zusammenführen konnte, sondern auch durch die Lektoratsphase gebracht habe und damit ein Roman, den ich sonst nie bei einem großen Verlag hätte veröffentlichen können, erschienen ist – darauf bin ich tatsächlich stolz.
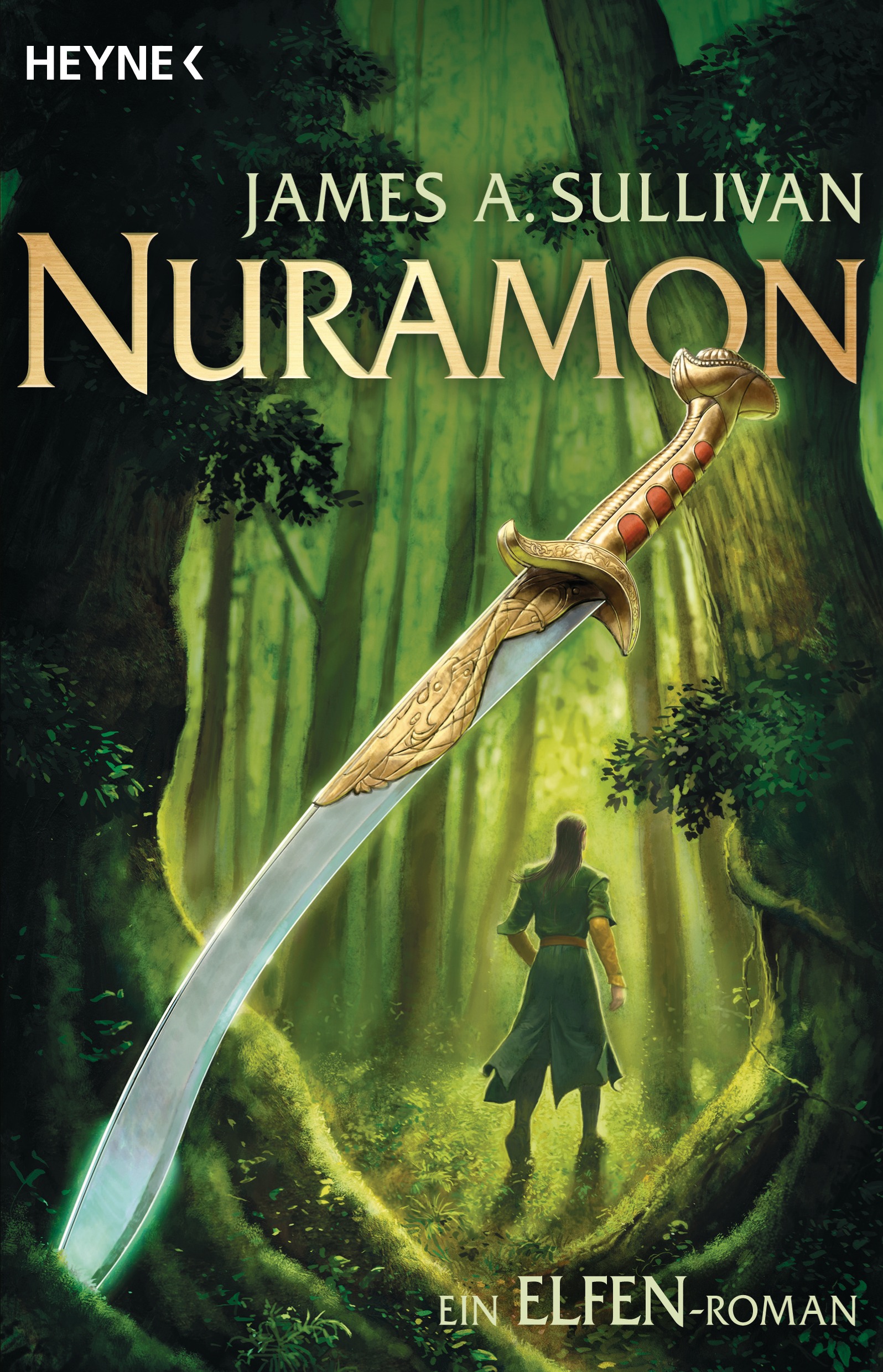
6. Welche Inhalte oder welches Genre würden dich für die Zukunft reizen – mal ganz unabhängig von Aspekten wie Verkäuflichkeit und Co.?
Ich würde gerne mal einen analytischen Phantastik-Krimi im Stil von Agatha Christie schreiben. Und ein Kinderbuch würde ich gerne mal schreiben. Ich habe da einiges, was ich meinen Kindern erzählt habe, das ich verschriftlichen sollte, ehe ich es wieder vergesse. Darüber hinaus habe ich einige so verrückte oder sogar größenwahnsinnige Ideen, die ich lieber für mich behalte. Aber bei allem gilt: Es hindert mich niemand daran, mich nebenher mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen. Es muss nicht immer ein fertiges Buch sein. Mir reicht es manchmal, mich in etwas hineingedacht zu haben, ein paar Notizen gemacht und vielleicht sogar ein paar Fragmente geschrieben zu haben. Es damit im Kopf immer wieder durchzuspielen, reicht mir manchmal.
7. Welchen Tipp würdest du deinem früheren Autoren-Ich geben?
„Trau dich mehr, und öffne dich früher nach außen.“ Das würde ich mit der Gewissheit sagen, dass dieses frühere Autoren-Ich eine eigene Timeline etabliert. Und ich würde mich fragen, was der Parallel-Jamie wohl daraufhin erlebt. Er hätte wahrscheinlich die vielen Leute nicht erst dann persönlich kennengelernt, nachdem er zehn Jahre im Geschäft war, sondern viel früher. Aber ich selbst bereue meine Zurückhaltung eigentlich nicht. Hätte ich diesen Tipp von meinem zukünftigen Ich erhalten und wäre ich ihm gefolgt, hätte sich alles anders entwickelt und vieles, was mir lieb ist, wäre nicht eingetreten. Das ist eine Sache, die mir, als ich Vater wurde, mit einem Mal so richtig klar geworden ist: Wäre auch nur eine Kleinigkeit in meinem Leben bis dahin anders verlaufen, dann mag es zwar sein, dass ich auch dann Vater geworden wäre, aber das wären dann andere Kinder geworden. Sie wären nicht die Individuen, die meine Töchter nun sind. Und das zu wissen, versöhnt mich komplett mit der Vergangenheit – auch mit negativen Dingen.
Vielen Dank!
*Eigentlich sollte die Reihe „Was sich (nicht) ändert“ heißen, aber mit dem Autorennamen dahinter klang das irgendwie unhöflich. Also hab ich getan, was ich immer tue, wenn mir ein passendes Wort fehlt: Ich habe irgendwas mit „stuff“ gebildet. #Qualitätsjournalismus
7 Gedanken zu „Veränderungen und stuff pt 1: James Sullivan“