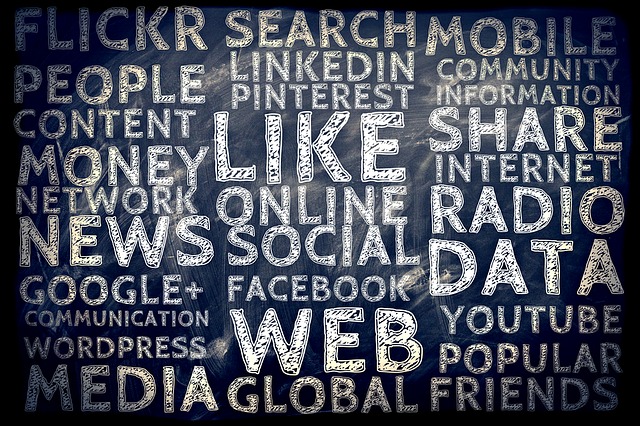
Von Digitalisierung, Angst und Faszination
Der nachfolgende Essay ist ein Beitrag zur Blogparade „Was nimmt dir die Angst vor der Digitalisierung?“ von BuGaSi. Man verzeihe mir das bunte Zusammenwerfen von Digitalisierung, Technologien und Cyberbla.
Es ist ein seltsames Ding mit der Digitalisierung. In der gesellschaftlichen Diskussion scheint sie zwischen zwei Polen zu pendeln. Auf der einen Seite ist das Misstrauen, die Angst vor Uniformität, Kontrollverlusten, der Veränderung der Arbeitswelt. Auf der anderen Seite ist da eine technologische Begeisterung, wie sie vielleicht seit Beginn des letzten Jahrhunderts nicht mehr existiert hat. Diese Digitalisierung dient vor allem ökonomischen Interessen und will visuell repräsentiert werden. (Andere) Gesellschaftliche oder inhaltliche Faktoren werden dabei hintenangestellt.
Digitalisierung zwischen zwei Extremen
Natürlich gibt es viel, was sich zwischen diesen beiden Extremen bewegt, doch sie sind es, die das Spannungsfeld erzeugt haben, in dem sich die Debatte um Digitalisierung derzeit befindet. Es ruft ein Klima hervor, in dem die Politik reagieren will und eigentlich auch muss – was dann nur leider in wirklichkeitsfremden Resultaten wie (Artikel 11 und) Artikel 13 gipfelt.
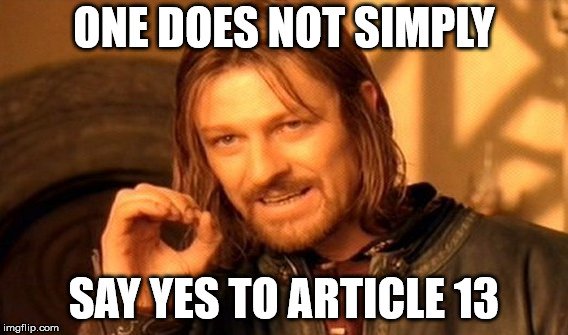
Ängste
Für mich hat sich die Frage, ob ich für Digitalisierung bin, nie gestellt. In meiner Familie standen früh Laptops und PC zur Verfügung, ich bin mit digitalen Lernspielen aufgewachsen und war ab meinem 14. Lebensjahr in virtuellen Communitys zu Hause. RL und VL sind und waren für mich dabei immer eng verknüpft.
Trotzdem kann ich das Misstrauen, die Angst, die mit Digitalisierung einhergeht, verstehen. Um nur mal drei oberflächliche Gründe dafür zu nennen:
- Die Gedanken fühlen sich nicht mehr so frei an, einmal digitalisierte Lügen, Irrsinnigkeiten, vergangene Ansichten verfolgen einen lange. Es ist eine von vielen Paradoxien, die das Netz kennzeichnen: Einerseits ist alles sehr schnelllebig, andererseits wird nichts vergessen.
- Die Hemmungen, einander zu verletzen, sinken. Damit meine ich nicht mal nur die ausgeprägte Trolllandschaft – ich habe das zweifelhafte Vergnügen, zur ersten Cybermobbing-Generation zu gehören. Worten auch nach der Schule nicht entfliehen zu können, ist nicht gerade shiny.
- Die technische Seite der digitale Welt ist von Hierarchien bestimmt, die sich nach dem Know-how richten. Noch so eine Paradoxie: Einerseits gibt das Netz jedem die Möglichkeit zur Selbstermächtigung und Partizipation. Andererseits bildet es eine Technokratie, eigentlich eine Abkehr von der Demokratie, liegt die Macht doch bei einigen wenigen. Selbst die eigene Identität unterliegt letztlich der Willkür von Admins.
- …
Und alles geht so schnell. Kaum hat man sich mit einer Technologie arrangiert, kommt schon die nächste. Manchmal würde ich am liebsten alles anhalten, meine Netzwerkkonten löschen und herausfinden, wie dieses Land jenseits der Cookie- und Alexawelten ist.
Faszinationen
-Aber zum einen bin ich mir der Naivität dieses Gedankens bewusst. Zum anderen will ich gar kein antidigitales Paradies, im Gegenteil – dafür bin ich viel zu fasziniert!
Hier ist es das zweite Extrem, die Innovationsbegeisterung, die ich nachvollziehen kann. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr im NetzpolitikCamp saß und von einigen Themen einfach nur mindblown war. Ein Gefühl, das ich seit den letzten Ethnologie-Seminaren vor fünf Jahren echt vermisst habe. Der Cyberspace wird zuweilen als „final frontier“ betrachtet, und tatsächlich gibt es nicht nur hier, sondern im Bereich des Digitalen generell ständig etwas Neues zu entdecken und zu erlernen.
Das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Ich bin die, die Smarthomes gruselig findet, erst seit vier Jahren ein Smartphone besitzt und Bücher immer noch im Print bevorzugt. Und dennoch – gerade das letzte halbe Jahr hat mir gezeigt, wie anstrengend, aber auch horizonterweiternd es sein kann, sich auf neue technisch-digitale Möglichkeiten einzulassen. Sie bieten ein krasses Entwicklungspotenzial, auf technischer, wissenschaftlicher, sozialer und auch persönlicher Ebene.
Unvollständiges Change Management
Aber apropos soziale Ebene: Die darf halt bei aller Innovationsfreude nicht außer Acht gelassen werden. Klingt wie eine Plattitüde, aber (nicht nur) in der E-Learning-Arbeitspraxis fällt mir immer wieder auf, dass das digitale Change Management Lücken aufweist. Eine technisierte Elite stößt immer wieder neue Türen auf, während weite Teile der Gesellschaft gerade erst das Atrium bestaunen. Zugleich wird der Ton innerhalb wie außerhalb der bereits digitalisierten Gesellschaft rauer, die Haltungen extremer.
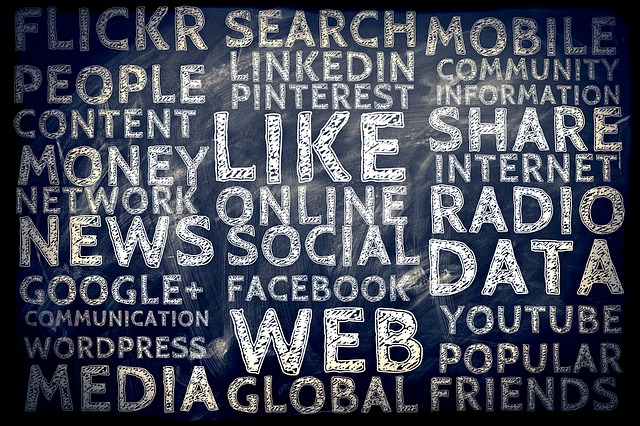
Die MINT-Fächer verkörpern den Zeitgeist wie schon lange nicht mehr, die Geisteswissenschaften werden dagegen belächelt, eher geduldet denn akzeptiert. Aber wir brauchen diese, wenn wir die sozialen Prozesse verstehen wollen, die mit der Digitalisierung einhergehen. Tablet-Klassen sind gut und schön, aber wie wäre es mal mit Medienpädagogik und -kompetenz?
Im Studium Leute wie Howard Rheingold oder Elizabeth Reid gelesen zu haben, lässt mich heute glaub ich weitaus besser nachvollziehen, was schief gelaufen ist – damals, als das Netz der Spielplatz einer Parallelwelt war, deren Freiheiten inzwischen so oft pervertiert werden. (Ok, in den 90ern war auch nicht alles rosa im Netz, es hat nur weniger Leute betroffen, die Ausmaße waren entsprechend kleiner.) Und dieses Wissen braucht es, wenn die künstliche Kluft zwischen analogem und digitalem Leben nicht noch größer und Versäumnisse aufgeholt werden sollen.
Eh … Hopepunk?
Sind wir damit wieder bei der Angst angekommen? Ja und nein. Das gesellschaftliche digitale Leben, so anstrengend es derzeit auch sein mag, ist auch ein inklusives, sichtbar machendes und einander verbindendes Leben. Wo wäre ich heute ohne die virtuellen Communitys meiner Teenagerzeit? Mit meinen Nischeninteressen Gleichgesinnte zu finden, wäre deutlich schwieriger gewesen. Und selbst wenn man das mal außer Acht lässt, ist mein Leben so von Digitalisierung im positiven Sinne geprägt, dass ich es mir ohne unmöglich vorstellen kann. Ich wäre ja quasi auch arbeitslos – die Digitalisierung mag einige Jobs überflüssig machen, doch zugleich kreiert sie viele neue.
Letztlich sind es drei Faktoren, die mir die Angst vor der Digitalisierung nehmen. Erstens die Faszination. Zweitens das Wissen um das Soziale in den sozialen Netzwerken. Und drittens – und das ist vielleicht das Wichtigste – die Freude am Paradoxen. Digitalisierung bedeutet Freiheit und Unsicherheit. Die virtuelle Welt vergisst alles und nichts. Sie eröffnet neue Welten und Möglichkeiten und engt sie zugleich ein. Digitalisierung bedeutet Inklusion und Ausschluss. Demokratie und ein zutiefst hierarchisches System. Verwirrung und Epiphanien.
Die Kunst besteht letztlich darin, diese Paradoxien von den Extremen zu trennen und in Einklang zu bringen. Kann ich jetzt die Postmoderne noch mal sehen?
2 Gedanken zu „Von Digitalisierung, Angst und Faszination“
Ah, ein schöner Beitrag. Ich komme seit Langem mal wieder dazu, Blogs zu lesen. ^^ Ich kann dir nur zustimmen, mir geht es da ähnlich. (Glaube, weil wir zur gleichen Generation gehören? Aber das muss nichts heißen.)
Meine eigentliche „Angst“ vor der Digitalisierung sind nicht die Digitalisierung und technische Fortschritte selbst sondern, wie du auch schon angerissen hast, der Mensch, der vor Begeisterung oder Gier zu weit vordringt und das auch noch viel zu schnell. Also, ich sehe die Herausforderungen im Moment stark im sozialen Bereich (der Umgang miteinander) als auch im ethischen (wie weit sollten wir gehen, Stichwort künstliche Intelligenz). Glücklicherweise geht es aber vielen Menschen so, siehe Formate wie Blackmirror (Netflix), die diese Fragen in Otto-Normal-Haushalte bringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir einen gesunden Umgang mit der „Technik Internet“ finden.
Danke dir 🙂
Es stimmt schon, in der Popkultur wird das Thema aufgegriffen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich die Stellen erreicht, an denen „entschieden“ wird. In Schulen oder an Hochschulen wird fleißig für den Einsatz der neuesten Technik geworben, aber die Medienkompetenz und -ethik wird dabei höchstens mal am Rande angeteasert.