Quo vadis, Lieblingsbuch?
Auf dem Blog Quergetippt wurde kürzlich im Rahmen einer Blogparade nach Lieblingsbüchern gefragt, was mich an einen dieser Artikel erinnert hat, die fragmentarisch im internen Blogovana vor sich hin schlummern. Eigentlich sollte der schon im Februar erscheinen, als Bloggerin Jule und der Diogenes-Verlag zu einer Leserunde von Joey Goebels „Vincent“ luden. Nun, es kam wohl irgendwas dazwischen, aber wenn wir wieder bei Lieblingsbüchern sind – geben wir dem Artikel noch eine Chance.
– – –
Dass ich Joey Goebels Romane sehr schätze, dürfte keine große Neuigkeit sein. Ich habe seine Bücher so oft verschenkt, dass ich langsam Verkaufsprovision verlangen sollte, außerdem mehrmals Romane von ihm verlost und dabei nicht eben dezent das Fangirl raushängen lassen. Auch wenn es um die Nennung von Lieblingsbüchern ging, durfte vor allem „Vincent“ nicht fehlen, das ich noch im letzten Jahr als „großartige, naive Dystopie“ bezeichnet habe. Das war allerdings ein paar Monate, bevor ich das Buch nach längerer Zeit noch einmal gelesen habe.
Utopien im Zeitalter der Kulturkritik
Ich war ungefähr 17 oder 18, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, und es ging mir eher semigut. In so einer Situation kommen Joey Goebels Romane, die immer irgendwo zwischen Satire, Coming of Age und Gesellschaftskritik pendeln, ziemlich gut. Er portraitiert Underdogs, die künstlerisch begabt sind, aber an der Gesellschaft scheitern. Interessanterweise nähert er sich der Utopie dabei aber stets genug an, um nicht zu sehr zu deprimieren: „Heartland“ ist ein Familiendrama, aber auch eine kommunistische Utopie. „Freaks“ endet in der Katastrophe, zeigt aber einen idealtypischen Freundschaftskosmos. Und „Vincent“? Kommt irgendwann immerhin zur Erkenntnis, dass man nach viel Scheiße doch noch glücklich werden kann.
Ich will nicht sagen, dass Vincent, der arme, von allen gequälte Künstler eine Identifikationsfigur war – das war er keineswegs. Aber die Art, wie Goebel diesen Roman geschrieben hat, fühlte sich damals sehr richtig an. Es war eines dieser Bücher, von denen man sich verstanden fühlt. Und so kam „Vincent“ an die Spitze meiner Lieblingsromane.* Konkurrenz gab es in den nächsten Jahren höchstens, als kurz nach meinem Abitur Goebels Nachfolgeroman „Heartland“ erschien.
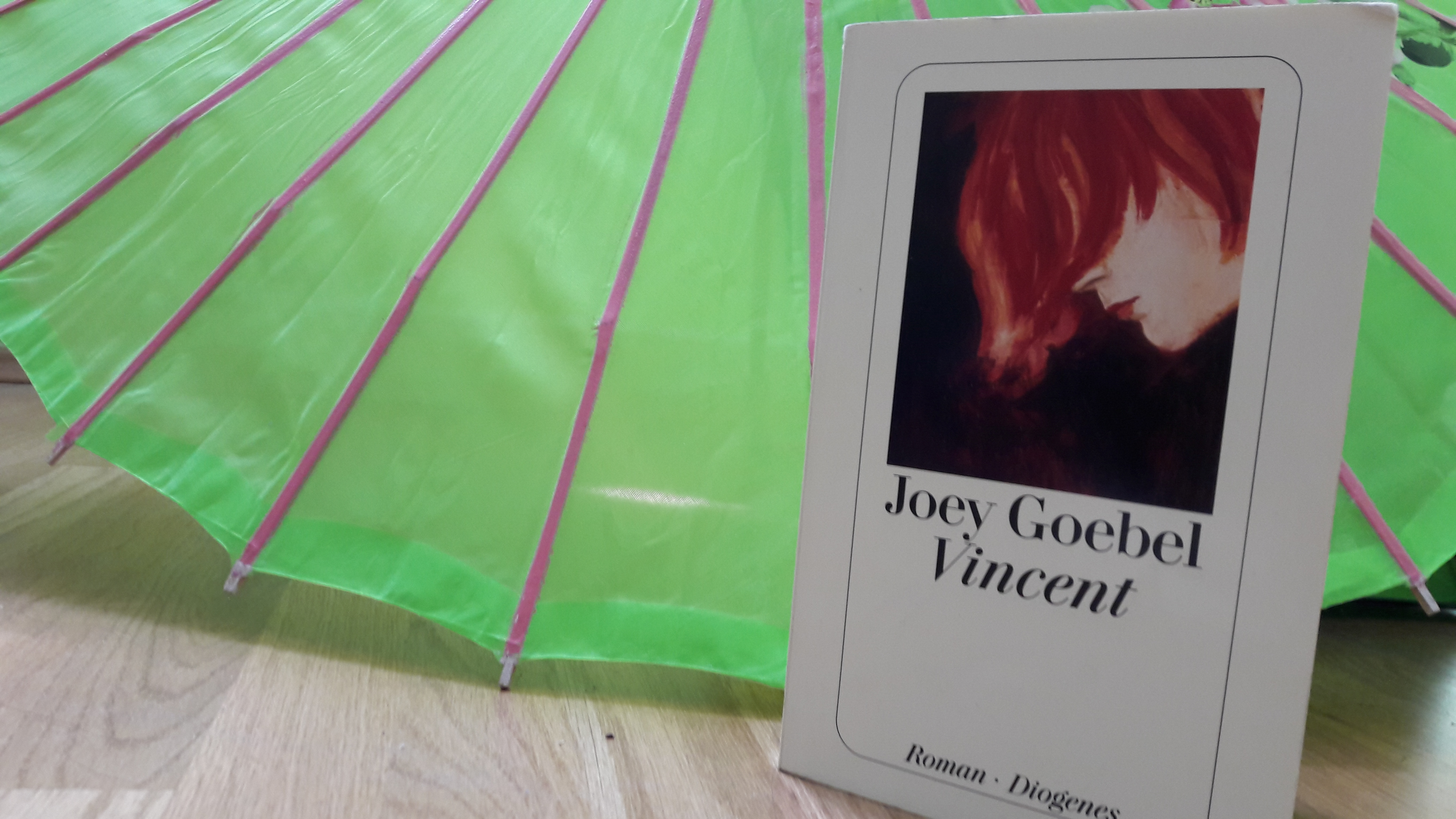
So schaut er aus. „Vincent“ von Joey Goebel
Warum denn so viel Drama?
Nun ist es nicht gerade eine neue Erkenntnis, dass sich Lieblingswerke abnutzen, egal, um welche Medien es geht. Die alten „Nightwish“-Alben etwa, die ich mit 14 Jahren rauf und runter gehört habe, kommen mir heute schon hart kitschig vor. Und Victoria Francés hat zweifellos viel zeichnerisches Talent, aber das mit dem Schreiben sollte sie vielleicht doch anderen überlassen.
Trotzdem, „Vincent“ blieb lange an der Spitze. Selbst, als mir dieser Leidender-Künstler-trope anfing, auf die Nerven zu gehen. Vielleicht lag die anhaltende Begeisterung weniger am Buch selbst, sondern mehr am Autor, der für mich der Einzige ist, bei dem ich bei einer Neuerscheinung schneller im Buchladen stehe, als die Exemplare ausgeliefert werden. Und dessen Bücher dann auch wirklich halten, was sie versprechen.
Oder es lag einfach daran, dass ich das Buch das letzte Mal mit 20 gelesen hatte. Als ich es nun wieder hervorholte, war ich jedenfalls enttäuscht. Das sollte „Vincent“ sein, mein Buch-Utopia und Versteher in der Not? Klar, Harlans Monologe waren immer noch ein Genuss und sprachlich kann man sich eh nicht beschweren.
Es waren vor allem inhaltliche Sachen, die mich nun störten. Das ewige Gebashe auf Popstars, mit denen Goebel eine persönliche Rechnung offen zu haben scheint. Die Kritik an einem Mediensystem, das nicht nur von Menschen gemacht, sondern so eben auch angenommen wird. Und nicht zuletzt die Darstellung der weiblichen Figuren, die beinahe ausschließlich bestechlich, triebgesteuert und sehr oberflächlich portraitiert werden. Der Held meiner Jugend war zu einem pubertierenden Nörgler geworden, der nicht fähig schien, die Welt auch mal aus einer anderen als seiner arty farty-Sicht zu sehen.
Selbsterkenntnis und so
In selbem Maße, wie „Vincent“ seinen Status verlor, rückte ein anderer Goebel-Roman auf. „Ich gegen Osborne“ erschien 2014 und anfangs war ich nicht so begeistert davon. Nicht, dass ich ihn schlecht fand, aber er packte mich weitaus weniger als „Vincent“ und erschien mir als recht konventioneller Coming of Age-Schulroman. Inzwischen interpretiere ich ihn jedoch etwas anders. James, der Protagonist des Buchs, ist wie die Personifizierung der „Vincent“-Botschaft: Er ist ein Möchtegern-Bohème, für den Nikes Feindsymbole sind und der ganz allgemein jeden verachtet, der sich lieber mit dem nahenden Abschlussball denn mit guter Musik / LiteraturTM beschäftigt. Die Art, wie er mit dieser Haltung selbst seine engste Freundin verkrault und seinen Mitschülern ein Fest verdirbt, in das sie über Monate hinweg ihr ganzes Engagement gesetzt haben, sollte selbst beim größten Anti-Mainstreamist für Kopfschütteln sorgen – was von Goebel zweifellos beabsichtigt gewesen war. „Ich gegen Osborne“ lässt sich als Entwicklungsroman sehen, vor allem aber als ironischen und vielleicht auch etwas nostalgischen Blick des Autors auf sein eigenes vorangegangenes Schaffen, insbesondere auf „Vincent“. Denn wo „Vincent“ – den Goebel mit 22 Jahren geschrieben hat – nur resigniert angesichts der Trash-Konkurrenz, da erkennt das acht Jahre später erschienene „Ich gegen Osborne“ den Wert von Kompromissen oder, positiver ausgedrückt, von Graustufen an. James unterteilt die Welt in Gut und Böse, Schwarz und Weiß, wie es auch der Roman „Vincent“ getan hat. Aber irgendwann muss man wohl erkennen, dass die Welt mehr Facetten hat als den Künstler und das commerce victim. Mit „Ich gegen Osborne“ ist diese Erkenntnis zumindest im goebelschen Kosmos vollzogen worden.**
Meine Leseempfehlung für Goebel-Romane kann damit guten Gewissens bestehen bleiben, wobei ich dazu rate, sie chronologisch zu lesen und nichts auszulassen – sonst macht auch „Ich gegen Osborne“ nur halb so viel Spaß.*** Mein aktueller Lieblingsroman ist jedoch „Nackt“ von Diablo Cody. Bin dann jetzt wohl doch mehr bei den Quarterlife-Crisis-Twentysomethings angekommen.****
*Und löste damit „Der Sohn der Sidhe“ ab.
**Und tatsächlich ist er der erste Autor, bei dem mir diese künstlerische Entwicklung so stark auffällt.
***Na gut, seine letzte, im Selfpublishing erschienene Anthologie „Summer Man and Other Black Comedies“ vielleicht schon. Die ist zwar auch nicht schlecht und für Goebelianer schon aus Statusgründen ein must have, fällt aber etwas aus dem Rahmen.
****Ich müsste hier noch irgendwo die Begriffe „postmodern“ und „Generation Y“ unterbringen.
3 Gedanken zu „Quo vadis, Lieblingsbuch?“