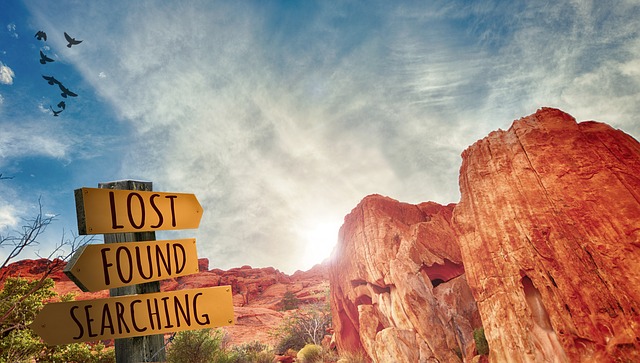
Die eierlegende Phantastik-Wollmilchsau …
… und ihre Dilemmata
Als ich 2012 die Verlagszusage für meinen Debütroman erhielt, verfasste ich seit gut acht Jahren für verschiedene Online-Portalen und Fanzines immer mal wieder Reportagen, Rezensionen oder Ähnliches. Teilweise tat ich das unter Pseudonym, teilweise unter meinem Realnamen.* Ein Problem war das nie gewesen, eher im Gegenteil – bis zu diesem Zeitpunkt. Denn kurz nachdem ich von Art Skript Phantastik die Zusage für die Veröffentlichung von „Vor meiner Ewigkeit“ erhielt, wollte ich Inhaberin Grit Richter für eine Interviewreihe anfragen, in der ich seit ein paar Monaten immer mal wieder Kleinverlage vorstellte. Plötzlich fragte ich mich aber, ob es nicht irgendwie nach Klüngelei aussehen würde, ausgerechnet die Frau zu interviewen, die mir die Chance für meine erste Romanveröffentlichung geben wollte. Andererseits wäre es auch suboptimal gewesen, ausgerechnet nicht diese Frau zu interviewen, da sie doch so ideal zum Thema passte.
Letztlich bat ich sie um das Interview und erklärte ihr gleichzeitig mein Dilemma. Sie meinte, sie sähe kein Problem – in der Phantastikszene sei doch eh jeder Autor auch Blogger.
Personalunion als Szenemerkmal
Nun, damit hatte sie recht. Eines der typischsten Merkmale der Phantasten ist es, dass sich fast jeder irgendwie als eierlegende Wollmilchsau versucht. Grit selbst ist nicht nur Verlegerin, sondern auch Autorin und Betreuerin (mindestens ?) zweier Blogs, Ingrid vom Ohneohren-Verlag ergänzt dieses Repertoire um ein Dasein als Lektorin und Ex-Mitarbeiterin beim eingestellten Fandom Observer und Jürgen Eglseer von Amrûn ist ohnehin so etwas wie ein Multifunktionsphantast (was ich mit allem Respekt erwähne). Gerade im Genre-, Indie-, Kleinverlags- und Fandombereich** ist Personalunion das bestimmende Prinzip.
Außerhalb nicht unbedingt. Als ich im vorletzten Jahr auf der Suche nach einem Volontariat war, landete ich auch zum Bewerbungsgespräch bei einem der üblichen verdächtigen Publikumsverlage für Fantasy. Da waren die Töne etwas anders – so richtig konnten sich meine beiden Gegenüber offenbar nicht vorstellen, wie ich im Lektorat arbeiten sollte, wenn ich gleichzeitig noch selber als Autorin tätig war und in Fanzines und Blogs munter über verlagsexterne Veröffentlichungen berichtete. Inzwischen lag mein anfängliches Dilemma drei Jahre zurück und das szenische Multifunktionsdasein war mir völlig selbstverständlich. Den Verlagsleuten weniger, und es überrascht wohl niemanden, dass mir die Stelle nicht angeboten wurde.***
Nun, gewissermaßen kann ich die Bedenken verstehen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass mir vermutlich schnell die Lust am Schreiben vergangen wäre, wenn ich 50 Stunden die Woche hätte Manuskripte lesen müssen****, sehe ich weiterhin ein paar … Stolpersteine in diesem Multifunktionsdasein. Sei es, dass man als Lektor oder Übersetzer anfängt, dem Schriftsteller den eigenen Stil hineinzueditieren, oder man vor lauter Kunstliebe die Ökonomie aus den Augen verliert, oder oder.
Die größte Problematik sehe ich allerdings im eigentlich sehr häufigen Verhältnis des rezensierenden Schriftstellers bzw. schriftstellerischen Rezensenten. Eine Erklärung in drei Punkten:
Problem 1:
Kollegen schlecht bewerten oder wie man sich ins Aus schießt
Schlechte Bücher können frustrierend sein. Vor allem, wenn man den Anspruch oder – bei Rezensionsexemplaren – die Pflicht hat, sie trotzdem auszulesen. Bei Rezensionsexemplaren gibt es hinterher aber immerhin ein Trostpflaster: die negative Besprechung.
Ja, nennt mich zynisch, aber negative Rezensionen zu verfassen kann durchaus sehr zufriedenstellend sein. Wann sonst kann man sich so sehr in Details suhlen, die Freude darüber ausleben, einen kleinen Fehler gefunden zu haben, die eigene Macht in feiner Ironie auskosten? Es ist nicht nett, und der Rezensent sollte sich ebenso wie der Autor davor hüten, persönlich oder beleidigend zu werden. Aber wenn die Gradwanderung gelingt, können aus Negativkritiken schnell interessante Artikel werden, deren Informations- und Unterhaltungswelt weit über den einer Standardrezension hinausgehen.
Nur: Andere Autoren öffentlich zu kritisieren, wenn man selbst einer ist, schreit in der öffentlichen Wahrnehmung nach Arroganz, Besserwisserei oder sogar Neid. Außerdem geht die Distanz verloren, die zwischen Journalisten und Künstlern durch ihre unterschiedlichen Medien bzw. ihren unterschiedlichen Blickpunkt auf diese normalerweise besteht, und die in der Regel dafür sorgt, dass die Beziehung zwischen beiden nicht nachhaltig gestört wird. Schlechte Kritiken werden von Leuten geschrieben, die es selbst nicht geschafft haben, lautet eine weitverbreitete Weisheit, mit der sich verschmähte Künstler trösten dürfen. Werden sie von Leuten geschrieben, die es doch geschafft haben, bricht die Aufteilung in Ihr und Wir auf. Der Künstler ist beleidigt, sein kritisierender Kollege ein Besserwisser, mit dem man lieber nicht mehr so viel zu tun hat – unabhängig davon, ob er Recht hat oder nicht.
Davon mal ganz abgesehen, tragen Negativrezensionen aus der Feder von Schriftstellern den Beigeschmack der Wettbewerbsverzerrung.
Problem 2:
Kollegen in den Himmel loben oder wie man sich unglaubwürdig macht
Nur weil negative Kritiken besonders viel Spaß machen, heißt das natürlich nicht, dass man nicht auch gerne mal etwas loben würde – im Gegenteil. Die Phantastikszene besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil aus dem Fandom und Fans haben die Eigenart, mitunter durchaus ins Schwärmen zu geraten. Wer ab und zu diesen Blog liest, weiß, dass ich dabei keine Ausnahme darstelle. Doch auch hier gibt es einen Beigeschmack, denn wer etwas allzu viel lobt, gilt schnell als Fangirl bzw. -boy. Und auch wenn die innerhalb der Phantasten selten durch Kreischanfälle auf sich aufmerksam machen, haftet ihnen doch auf die Dauer selbst in der Geek Culture etwas Unprofessionelles an.
Hinzu kommt, dass es schnell nach einer Gefälligkeit aussieht, wenn man sich positiv über das Werk von jemandem auslässt, mit dem man befreundet ist.***** Amazon löscht inzwischen bekanntlich sogar Kritiken, wenn (auf verworrenen Wegen) eine Verbindung zwischen Werk/Künstler und Rezensenten angenommen wird. Was einen nicht ganz sinnlosen Kern haben mag – Gefälligkeitsrezensionen sind nun mal so eine Sache –, kann gerade in der stark vernetzten Phantastikszene ein zweischneidiges Schwert sein.
Problem 3:
Kollegen überhaupt bewerten
Kritik ist also problematisch, Lob aber auch. Und leider gilt es für alles dazwischen ebenfalls. Ich werde hin und wieder von anderen Autoren angeschrieben, die mich um Verzeihung bzw. Erlaubnis für eine Rezension bitten, die nur drei Sterne hätte. Skandal! Hierzulande gilt offenbar alles unter vier Sternen als schlecht und ein Dreierstern kann schon mal das Ende einer Freundschaft bedeuten. Tatsächlich habe ich diese Erfahrung selbst schon gemacht, als ich das Buch eines (damals) befreundeten Schriftstellers mit garstigen drei Sternen bewertete und daraufhin eine sehr angesäuerte Nachricht von ihm erhielt. Inzwischen hat er mich sogar aus seiner Freundesliste gekickt. Sozialer Exodus! Rückblickend denke ich, ich hätte sein Buch einfach gar nicht bewerten sollen. Ich habe damit kein Problem, aber manche haben es offenbar und betrachten Rezensionen nur dann als hilfreich, wenn es sich eben um offenkundige Gefälligkeitsrezis mit fünf strahlenden gelben Zacken handelt. Im Prinzip gilt hier das Gleiche wie bei den Negativkritiken: Man maßt sich an, über die Werke anderer Leute richten zu können, und das ist vielleicht nicht so … diplomatisch.
*
So viel zu den Problemen, die zur Folge haben, dass ich tatsächlich so gut wie keine Rezensionen mehr schreibe. Gelegentlich gibt es Ausnahmen – etwa für die pausierende „Früher war alles anders“-Reihe oder bei Werken ausländischer Autoren, die sich ohnehin nicht groß um meine Worte scheren dürften. Aber von den klassischen Rezensionen, wie ich sie früher auf Portalen veröffentlicht habe, bin ich weitgehend weg.
Trotzdem schreibe ich immer mal wieder kleine Bewertungen, etwa durch die Top 7-Listen. Das hat so schlichte Gründe wie Spaß an der Sache, so ideologische wie Meinungsfreiheit, und so theoretische wie den, dass ich ganz einfach auch Vorteile darin sehe. Kommen wir daher zur anderen Seite der Medaille – den Vorteilen.
Vorteil 1:
Man hat (hoffentlich) Ahnung
Ich will mir jetzt sicher nicht herausnehmen, die ultimative Ahnung von Handlungsstrukturen, idealer Figurenzeichnung etc. pp. zu haben. Hab ich nicht. Aber manchmal lese ich z. B. ein Buch und denke „lol, da hat sich wohl der Lektor beschwert“. Da sind dann Absätze, die stilistisch danach schreien, nicht „aus einem Guss“, sondern nachträglich eingefügt worden zu sein. Früher wäre mir sowas nie aufgefallen, heute springt es mich förmlich an. Dasselbe gilt für Genre-Tropes oder irgendwelche Phrasen. Ich schreibe ungern über Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne – was auch der Grund ist, weshalb es hier auf dem Blog so selten um Musik oder Computerspiele geht. Aber umso lieber schreibe ich über etwas, von dem ich halbwegs Ahnung habe, und auch als Leser schätze ich es, wenn ein Verfasser weiß, wovon er schreibt. Sportler versuchen sich oft als Kommentatoren in ihrer eigenen Sportart – warum sollten Künstler, ob es nun um Schriftsteller, Musiker, Maler oder sonst jemanden geht, sich dann nicht auch über das auslassen, wovon sie (mehr oder weniger) Ahnung haben?
Vorteil 2:
Man schafft Verflechtungen und Vernetzungen
Herrje, wir leben im 21. Jahrhundert! Die Welten von Journalisten und Autoren sind ebenso wenig getrennt wie die von Musikern und Autoren. Und für Blogger, Rezensenten aller Art und Schriftsteller sollte das gleichermaßen oder vielleicht sogar noch mehr gelten, ebenso wie für Verleger und Übersetzer, Lektoren und Autoren. Wo Trennungen überwunden werden, können interessante Verflechtungen, neue Spielarten und Stilformen entstehen. Warum sich davon künstlich fernhalten?
Vorteil 3:
Man kennt mehrere Seiten
Als Schriftsteller ist es immer leicht, über den Verleger, den Blogger oder Agenten zu schimpfen. So, wie das eben ist, wenn man die andere Perspektive nicht kennt. Tritt man aber in verschiedenen Positionen auf, kennt man die spezifischen Problemchen mehrerer Seiten und kann sie in Einklang bringen. Beispielsweise kommen mir Verlage, die von Leuten geführt werden, die ebenfalls Erfahrung als Autor in anderen Verlagen haben, oft fairer vor, was die Vertragskonditionen angeht. Blogger oder Rezensenten, die als Schriftsteller arbeiten, haben ebenso wahrscheinlich mehr Verständnis beispielsweise für Autorenanfragen oder -absagen und anders herum. Auch entsteht so leichter ein Verhältnis auf Augenhöhe, das mir sonst doch gerade in der Autoren- Bloggerbeziehung****** manchmal fehlt.
*
Mein ultimatives Fazit lautet also: Dilemma ist da und bleibt bestehen. Wie er es für sich löst, muss jeder selbst entscheiden. Ich fahre mit meinem Rezensionen-Nein, Top-Listen-Ja derzeit ganz gut.
Wie sieht das bei euch aus? Seht ihr überhaupt Probleme bei dem Thema?
* Übrigens auf Anraten eines Dozenten, der meinte, ich solle meine Artikel als Arbeitsproben bei Bewerbungen nutzen. Durchaus kein doofer Tipp, und es wäre irgendwie unintelligent gewesen, die Proben unter Urheberschaft eines Namens wie Smeralda Serafin einzusenden (nein, diesen Nick habe ich nie benutzt).
** Leute, es ist schwierig, alle Begriffe aufzuzählen, mit denen sich möglichst niemand mehr als den Schlips getreten fühlen kann.
*** Es kann unmöglich einen anderen Grund geben.
**** Ehrlich, ich beneide Lektoren nicht besonders.
***** Ganz abgesehen davon, dass es dem Gelobten manchmal auch unangenehm ist.
****** Ich rede in diesem Fall bewusst von (rezensierenden) Bloggern statt von Rezensenten. Portal-Rezensenten /-Mitarbeiter genießen in meiner Wahrnehmung mehr Ansehen als der Ein-Mann/Frau-Blogger – egal, ob es sich dabei um einen Rezensions-, Szene- oder Buchblog handelt.
14 Gedanken zu „Die eierlegende Phantastik-Wollmilchsau …“
Ausgezeichneter Beitrag!
Auch wenn ich kein Autor bin, kommt mir die Problematik als bloggender und rezensierender Übersetzer bekannt vor. Rezensionsexemplare bespreche ich inzwischen nicht mehr, da ich keine Lust habe, Bücher, die mir nicht gefallen, zu Ende zu lesen (bespreche aber durchaus Bücher, die ich einfach so privat lese). Aber ich berichte ja auch gerne mal kritisch über die Szene, den Buchmarkt und die Verlage (wie im letzten Jahr zum Beispiel über die Frage, wo die Frauen in den phantastischen Programmen seien?), aber da es eben auch jene Verlage sind, die mir meinen Lebensunterhalt sichern, ist das oft eine heikle Angelegenheit (von wegen die Hand beißen, die einen füttert). Da bin ich schon sehr vorsichtig in meinem Formulierungen und meiner Kritik geworden.
Und was z. B. Kritik an Übersetzungen angeht (also die Arbeit von Kollegen bewerten), warum eigentlich nicht? Viele Übersetzer wären froh, wenn die Rezensenten im Feuilleton oder in Magazinen ihre Übersetzung mal loben würden bzw. sich eingehend mit ihr beschäftigen würden, und nicht so tun, als würde Stephen King auf Deutsch schreiben. Warum sollte man das dann nicht auch als rezensierender Übersetzer machen, immerhin weiß man ja, wovon man dann schreibt (wie z. B. gestern Frank Heibert http://tell-review.de/die-literarische-stimme-und-der-satzbau/)
Und es wäre doch furchtbar, wenn Autoren nicht mehr mitteilen, welche Bücher ihnen besonders gut gefallen haben, oder welche sie nicht mögen. Wenn einer einem wegen einer Dreisterne-Wertung die (Facebook-)Freundschaft kündigt, wäre das für mich auch niemand, bei dem ich unbedingt Wert auf eine Freundschaft legen würde.
Und die deutschsprachige Phantastikszene ist sowieso eine sehr inzestuöse Veranstaltung, wo jeder irgendwie mit jedem verbandelt oder vernetzt ist, und wo die Grenzen zwischen Fandom und professioneller Tätigkeit fließend verlaufen.
Danke 🙂
Bei Übersetzungen ist es für nicht-affine Leser natürlich schwierig, viel dazu zu sagen. Ich habe dazu zweimal in Rezensionen etwas geschrieben – einmal ging es um einen Drachenlanze-Roman, einmal um die uneinheitliche Übersetzung von Namen und Begriffen in „Ich gegen Osborne“. Beide Male fiel mir die Übersetzung negativ auf. Fällt sie positiv auf, bezieht man das eher auf den Autor selbst. Insofern kommt hier noch stärker bzw. sehr deutlich der „erste Vorteil“ zum Tragen. Was ja auch im Sinne der Rezensionsleser ist.
Der Artikel spricht mir aus der Seele. Ich bin selbst auch so eine Eierlegendewollmilchsau die im Grunde fast alles macht: rezensieren, schreiben, Buchcover gestalten, Buchsatz. Ich bin Grafikdesignerin, Illustratorin, Buchbloggerin und nun auch Autorin. Das ist teilweise eher ungeplant passiert, aber so läuft es eben oft. Es war schon grenzwertig von der Leserin zur Gestalterin zu werden, weil ich mir da schon das Kritisieren gewisser generischer Buchcover abgewöhnen musste. Dann fing ich mit den Rezensionen bei einem Rezensionsportal an (Bibliotheka Phantastika), bin vor 2-3 Jahren auf den eigenen Buchblog umgezogen und nun wird bald – eher unbeabsichtigt – mein erster Roman veröffentlicht. Seitdem mache ich mir wieder vermehrt Gedanken darum, wie das mit den Rezensionen in Zukunft laufen darf. Ich denke ich bin in sofern erstmal noch gut dran, weil ich zu 99% englischsprachige Bücher lese und rezensiere. Da interessieren sich der Autor/ die Autorin, wie du schon selbst sagst, nicht dafür was eine kleine deutsche Autorin/Bloggerin schreibt. Aber als ich neulich das Buch einer Kollegin aus „meinem“ Verlag las, stand ich am Ende mit einem Fragezeichen im Gesicht da. Ich habe mich dann dagegen entschieden das Buch zu rezensieren, weil ich die Autorin nicht persönlich kenne und sie meine Kritikpunkte (es wäre eine 3-Sterne Rezi geworden), vermutlich als Konkurrenzgehabe interpretieren würde. Hätte ich 4 oder 5 Sterne vergeben können, wäre mir die Reaktion anderer Menschen dagegen wohl eher egal gewesen. Sehr gute Bücher zu loben ist mir wichtiger als der Vorwurf der Klüngelei. Aber es ist plötzlich alles ein Drahtseilakt. Als Rezensentin ändert sich für mich durch das eigene Buch nichts. Der Lesestoff wird bewertet wie immer, mit den entsprechenden Erklärungen im Text. Aber die Situation ist mir zu heikel, als dass ich da unbeabsichtigt ins Bienennest stechen und jemanden verärgern möchte, der mein Buch später aus Rache schlecht bewertet. Darum werde ich deutsche Autoren/ Autorinnen in Zukunft wohl nicht mehr im Buchblog besprechen. Schwierig.
Ich hoffe, dass es in Zukunft weiterhin funktioniert, wenn ich bei den englischsprachigen Büchern bleibe. Denn mir würde doch ein erheblicher Teil fehlen, wenn ich das Rezensieren aufgeben müsste, nur weil ich nun auch zu den Autorinnen zähle.
Liebe Grüße,
Sam
Hallo Sam.
„Ich denke ich bin in sofern erstmal noch gut dran, weil ich zu 99% englischsprachige Bücher lese und rezensiere.“
Ich habe ja auch geschrieben, dass ich hier weniger Probleme sehe. Andererseits ist es natürlich schade – deutschsprachige Bücher bekommen ohnehin schon weniger Aufmerksamkeit durch Leser. Wenn man sich selbst einen Riegel vorschiebt, diese Bücher zu besprechen (oder sogar zu lesen), schadet man ihnen damit wiedeurm (und sich selbst). Aber das ist letztlich ja auch eine Frage des eigenen Geschmacks.
Liebe Grüße und viel Erfolg mit deinem Debüt!
Ah, ein sehr schöner Beitrag, der genau das Dilemma einfängt. Als Buchhändler/ Autor fühlte ich mich gelegentlich auch wie eine gespaltene Persönlichkeit, wenn ich wie ein Buchhändler handeln musste, der Schriftsteller in mir aber genau wusste, dass das nicht gut für die Kollegen ist. Im Unterricht führte das dann zu teilweise kontroversen Äußerungen von mir, die bei den anderen Mitazubis nur zu großen Fragezeichen führten. Klar, ich hab wohlweißlich niemandem erzählt, dass da ein Schriftsteller unter ihnen ist, der das Bücherverkaufen lernen will. (Wobei ich zugeben muss, dass ich sowieso dazu neige aus der Reihe zu fallen und quer zu schießen und nicht zu allem ja und Amen zu sagen. 0:-) ) Das eigentliche Problem, also diese Spaltung, ist mir auch erst richtig bewusst geworden nachdem ich nicht mehr als Buchhändler arbeitete. Möglich, dass man sich also daran gewöhnt, und gar nicht merkt wie es einen verändert oder ob/ dass es ein Problem für einen ist.
Dass Rezensieren und Schreiben nicht immer Hand in Hand gehen, habe ich auch eine Weile gebraucht zu erkennen. Eigentlich kam das Rezensieren aus der Ausbildung, weil es ja für Buchhändler völlig „normal ist, zu bloggen“. *rolling eyes* Aber eigentlich war das immer schon erschöpfend, weil ich alles andere als Lust hatte, Bücher zu lesen, die mich nicht interessieren (weil man idR. drei Meilen gegen den Wind riechen konnte, dass sie als Genreliteratur vielleicht gut sind, aber nicht einzigartig oder irgendwie auf neue Art bereichernd), sich aber gut verkaufen und gut nachgefragt sind. Mit dem Rezensieren war das auch so. Glücklicherweise habe ich von Anfang an keine TiZis rezensiert, weil mir das, wie du schon schreibst, zu bevormundend herüber kam. Ich mein, warum rezensiert man denn? Klar, im Laufe der Jahre sammelt sich einiges an Skillz und Wissen an – aber es ist ja nicht meine Aufgabe, Romane auf diesem Level zu rezensieren. Ich bin kein Lektor, ich bin kein Lehrer, ich werde nicht für diese Arbeit bezahlt, noch wird sie überhaupt verlangt. Im besten Fall ignoriert der Kollege die Rezi, im schlimmsten Fall ist er dann sauer. Wäre ich auch, wenn sich jemand ungefragt so in mein Zeug einmischt, ohne dass ich Stellung beziehen oder auf sonst eine Art eine für beide Seiten gewinnbringende Diskussion/ Erörterung führen könnte. (Das Werk ist fertig, da veröffentlicht. Im Nachhinein dran herumzudoktern, ist eher… meh.) Vielleicht war mein Ansatz wie ich Rezis schreibe, auch falsch. Nur bin ich längst über den Punkt hinaus, Bücher ohne mein schriftstellerisches Wissen bewerten zu können. (Dass man sich am Ende selbst hinein schreibt, ist, denke ich, nur die Extremform. Zumindest denke ich, dass mir das noch nicht passiert ist. ^^“)
Nun ja, jedenfalls, das Ende vom Lied ist, dass ich mich über kurz oder lang darauf zurück besonnen habe, dass ich in erster Linie als Schriftsteller wahrgenommen werden will und habe das Rezensieren eingestellt. Einfach nur für mich zu lesen und für mich zu schimpfen oder zu jauchzen, kann auch sehr befreiend sein.
Ach ja, die Buchhändler habe ich bei dem Artikel ganz vergessen. 😮 Aber kann mir gut vorstellen, dass die Problematik da ebenfalls besteht, ebenso wie ihre Vorteile. Eine befreundete Autorin hat vorher als Buchhändlerin gearbeitet, und ich finde es immer spannend, ihre Sichtweise zu hören, wenn eine Diskussion über die Genreschubladen ausbricht 😉
Finde es aber interessant, dass du das Bloggen als typisch für Buchhändler-Azubis ansiehst. Ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch für einen Ausbildungsplatz, aber als das Gespräch auf meine Rezensionen kam, haben meine Beinahe-Chefinnen betont, dass ich solche als Buchhändlerin nur unter Pseudonym verfassen sollte. Ist aber ja auch schon 8 Jahre her, damals war das eh noch nicht so en vogue.
„Einfach nur für mich zu lesen und für mich zu schimpfen oder zu jauchzen, kann auch sehr befreiend sein.“
Da sprichst du was an. Ich habe auch das Gefühl, Bücher eigentlich wieder entspannter zu lesen, seit ich nicht mehr rezensiere. Früher dachte ich, ich müsste immer 10 Notizen für jede Seite machen. Heute genieße ich die Bücher einfach =)
Lustig, dass Du gerade dieses Thema aufbringst. Ich wollte meinen Anthologien-SuB mal wieder mittels Kurz-Rezensionen abbauen (habe ich letztes Jahr um ungefähr diese Zeit schon angefangen). Ursprünglich hatte ich das begonnen, weil ich es sehr schade finde, dass einzelne Geschichten in der Regel nicht bewertet werden, und viele Leute in meiner Facebook-Liste hatten mit dem Slogan „Sei die 10 Prozent“ (oder so ähnlich) versucht, die Bedeutung von Rezensionen mehr in den Fokus zu rücken.
Ich fand es mit dem eigenen handwerklichen Hintergrund sogar leichter, Rezensionen zu schreiben. Wäre ich nur Leser, bliebe mir nichts übrig, als zu schreiben: „Mann, durch diese Geschichte musste ich mich durchquälen, die hat mir einfach nicht gefallen, Punkt.“ Warum nicht? Wieso denn? Keine Ahnung.
Aber mit dem Autoren-Auge, das durch die Beschreibungen auf das Skelett der Geschichte blickt, habe ich immer den einen oder anderen positiven Punkt gefunden, den ich erwähnen kann. Oder auf der Suche danach (weil ich die Geschichte nicht einfach so abhaken wollte und mir vorgenommen hatte, diese Kurz-Rezension zu schreiben) fielen mir positive Aspekte auf, an die ich zuerst nicht gedacht hatte. Sie sind mir mit dem Leser-Auge nicht so stark aufgefallen.
Und das, was mir nicht gefallen hat, kann ich so verpacken, dass sich der Empfänger nicht gekränkt fühlt. Die Rezensionen zu den Geschichten, die mir nicht so gefallen haben, wurden von den Verlagen ebenfalls verlinkt oder retweetet. Kann sich also nicht so schlimm angehört haben.
Als ich vor 10 Jahren noch nicht soviel Schreiberfahrung hatte, fiel mir das deutlich schwerer und das Ergebnis war auch nicht annähernd vergleichbar. (Aber Donna W Cross hat mir noch keinen Beschwerdebrief geschrieben, also kann ich diese Jugendsünden abhaken.)
Jetzt liegt es eher an Prokrastination. Vielleicht sollte ich mir einen festen Tag in der Woche vornehmen, oder am besten zwei, sonst hänge ich ein jahr lang an 3 Büchern. Dann kaufe ich wieder schneller als ich lese 😀
Na, ich denke, man muss nicht unbedingt Autor sein, um ein Buch bewerten zu können 😉
Solche Jugendsünden habe ich auch zur Genüge. Aber die waren auch handwerklich einfach weniger ausgereift, da kommt heute (hoffentlich) dann doch die journalistische Ausbildung zum Tragen. Was wiederum nicht heißen soll, dass man ohne eine solche Ausbildung keine Rezensionen schreiben kann. Das Spannende ist ja gerade, dass sich durch all die Hintergründe die Perspektiven ändern.